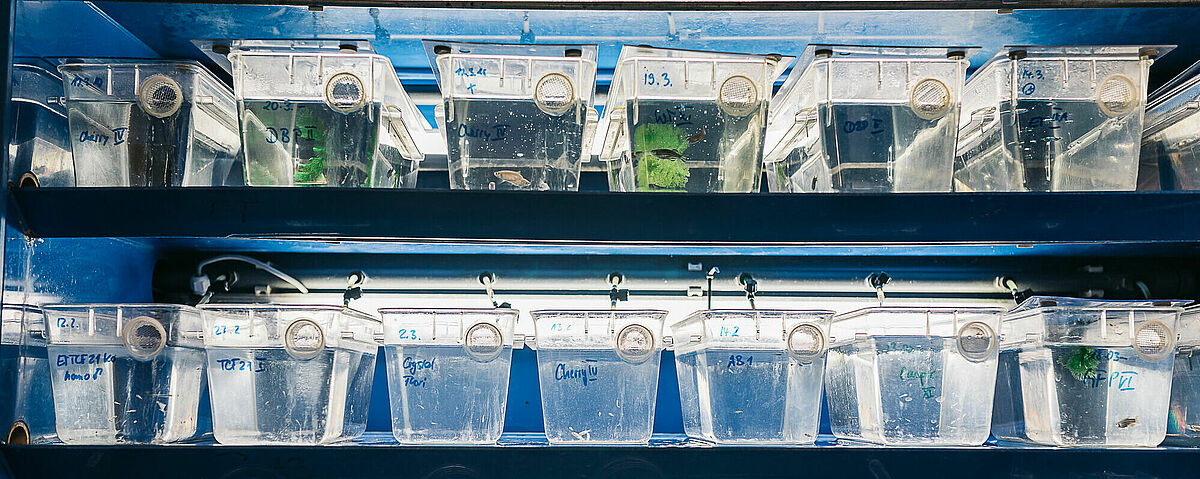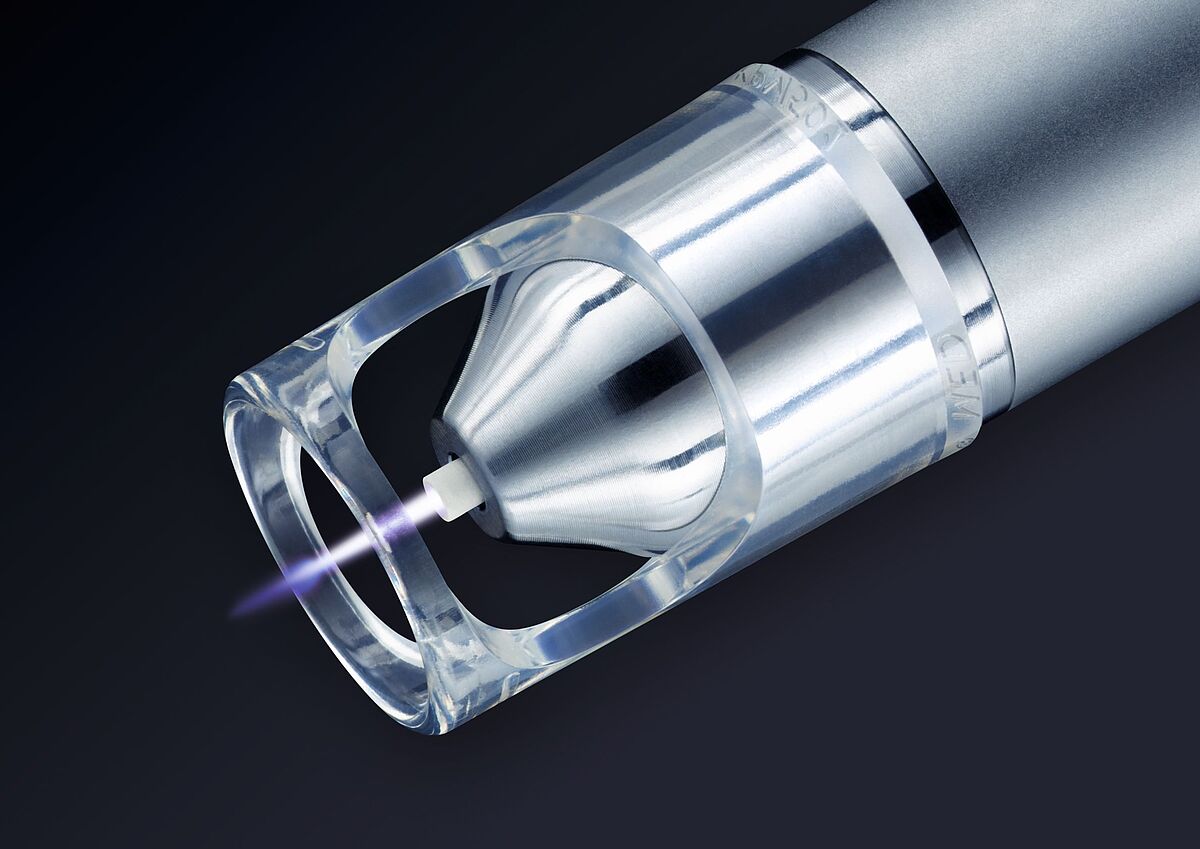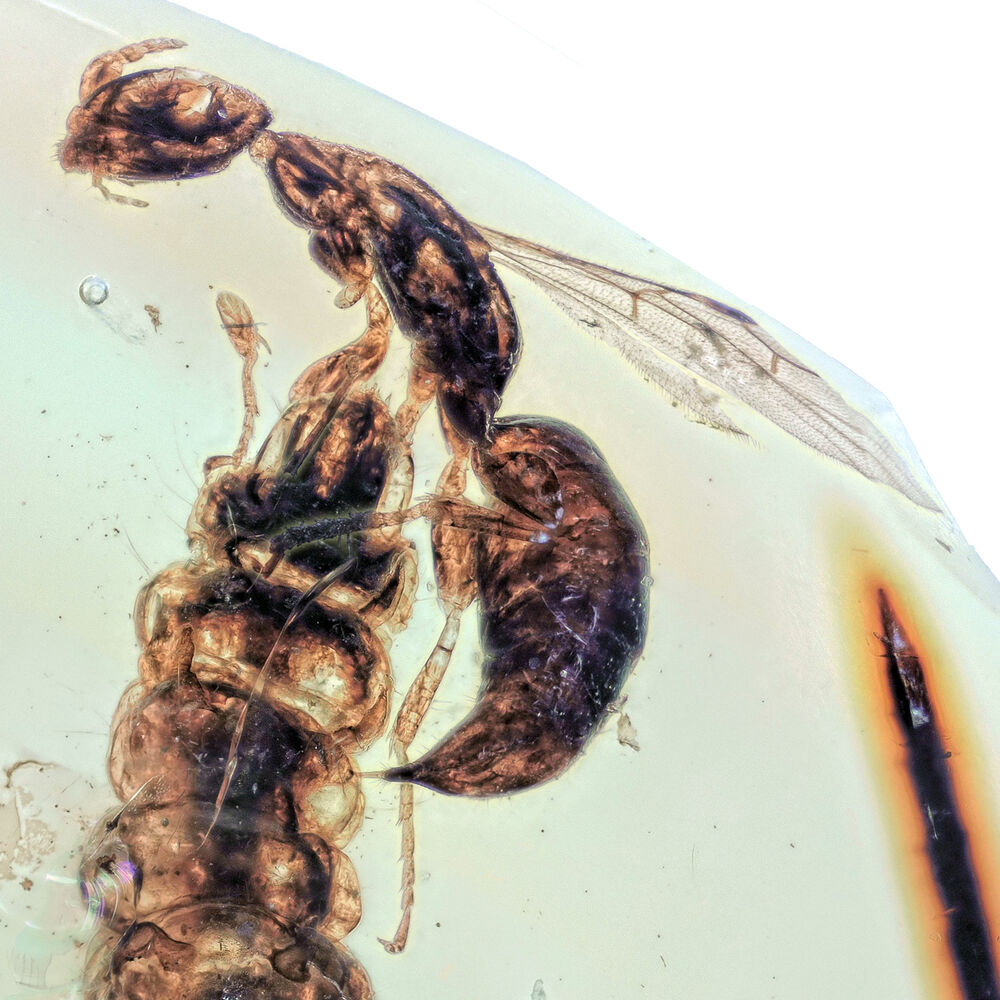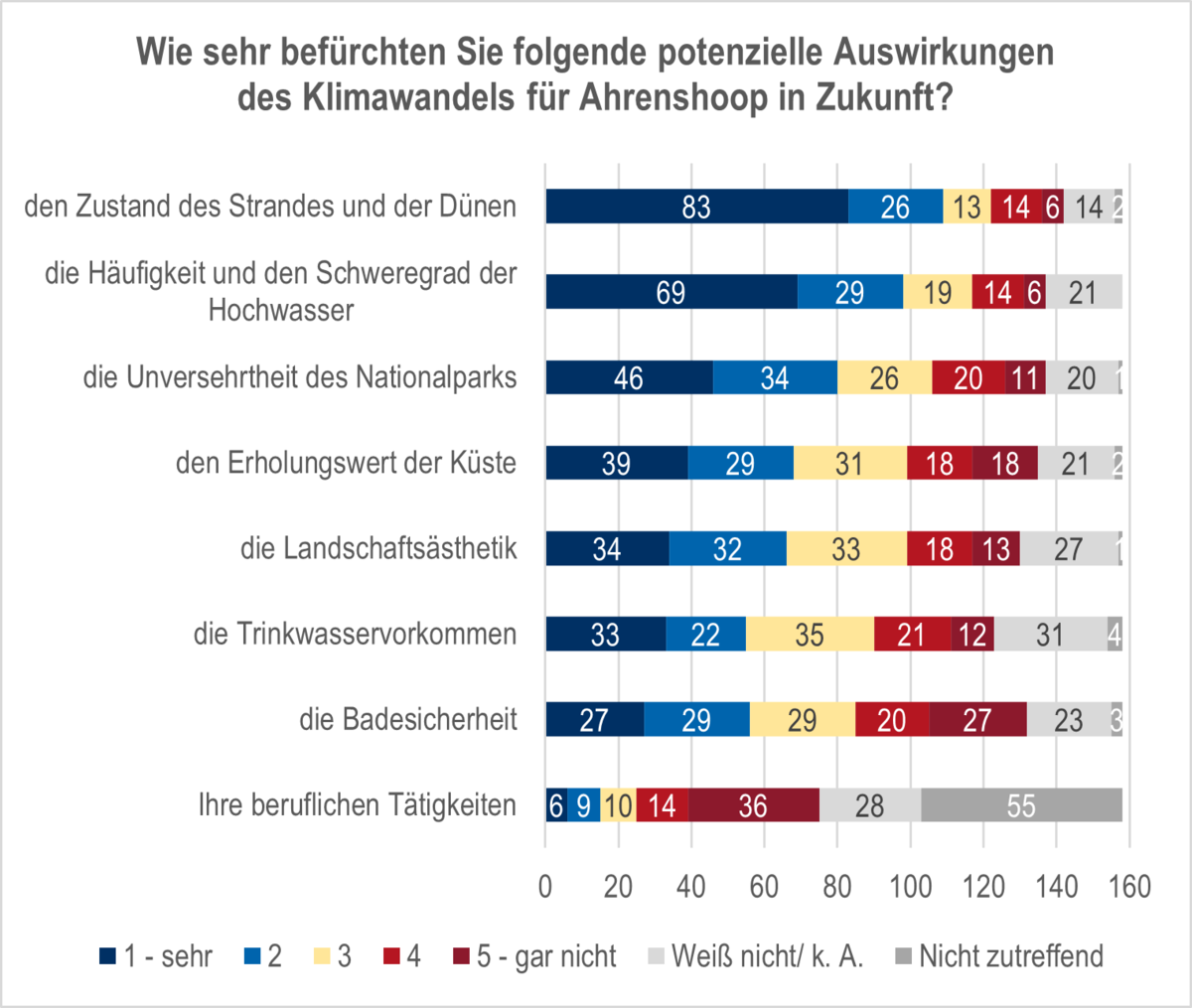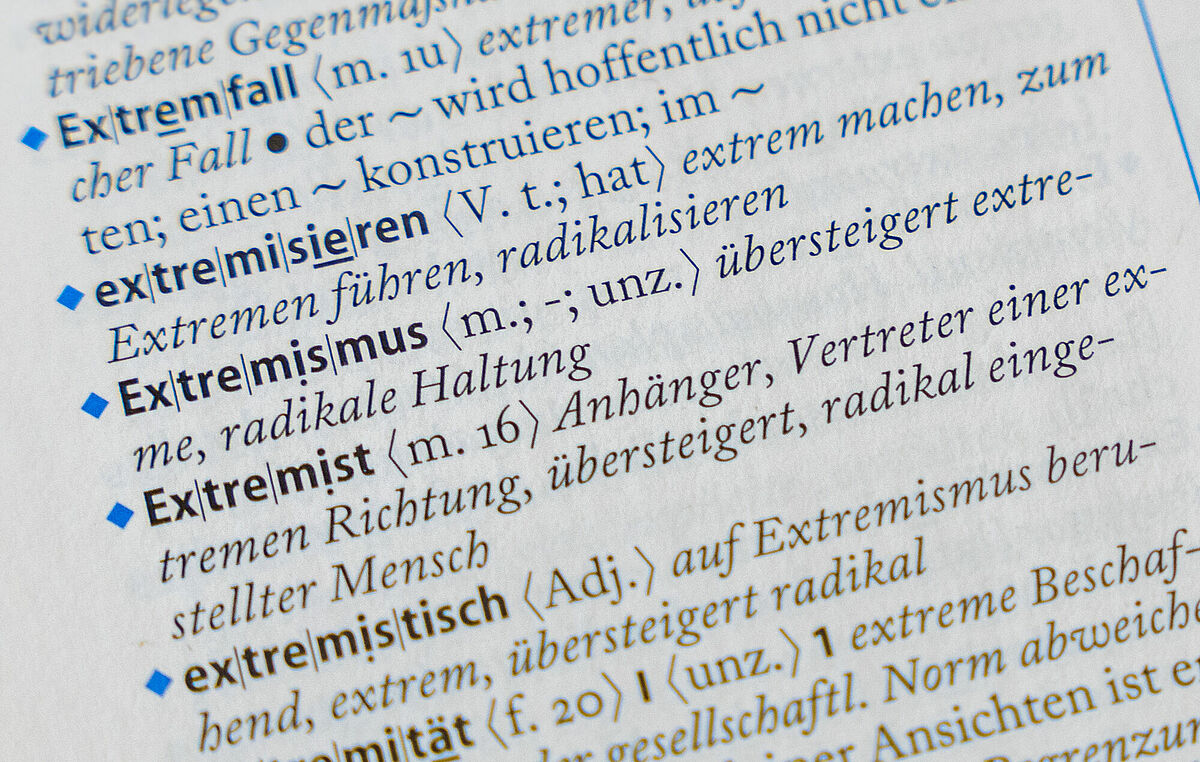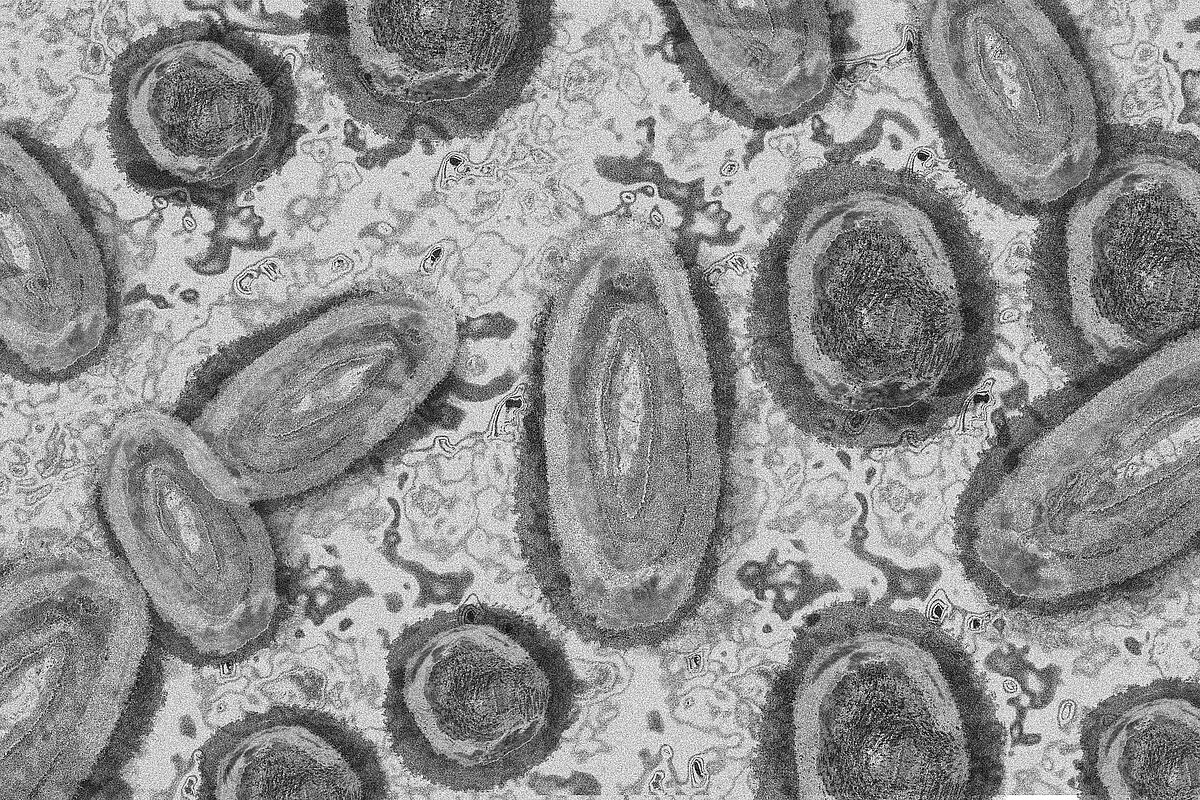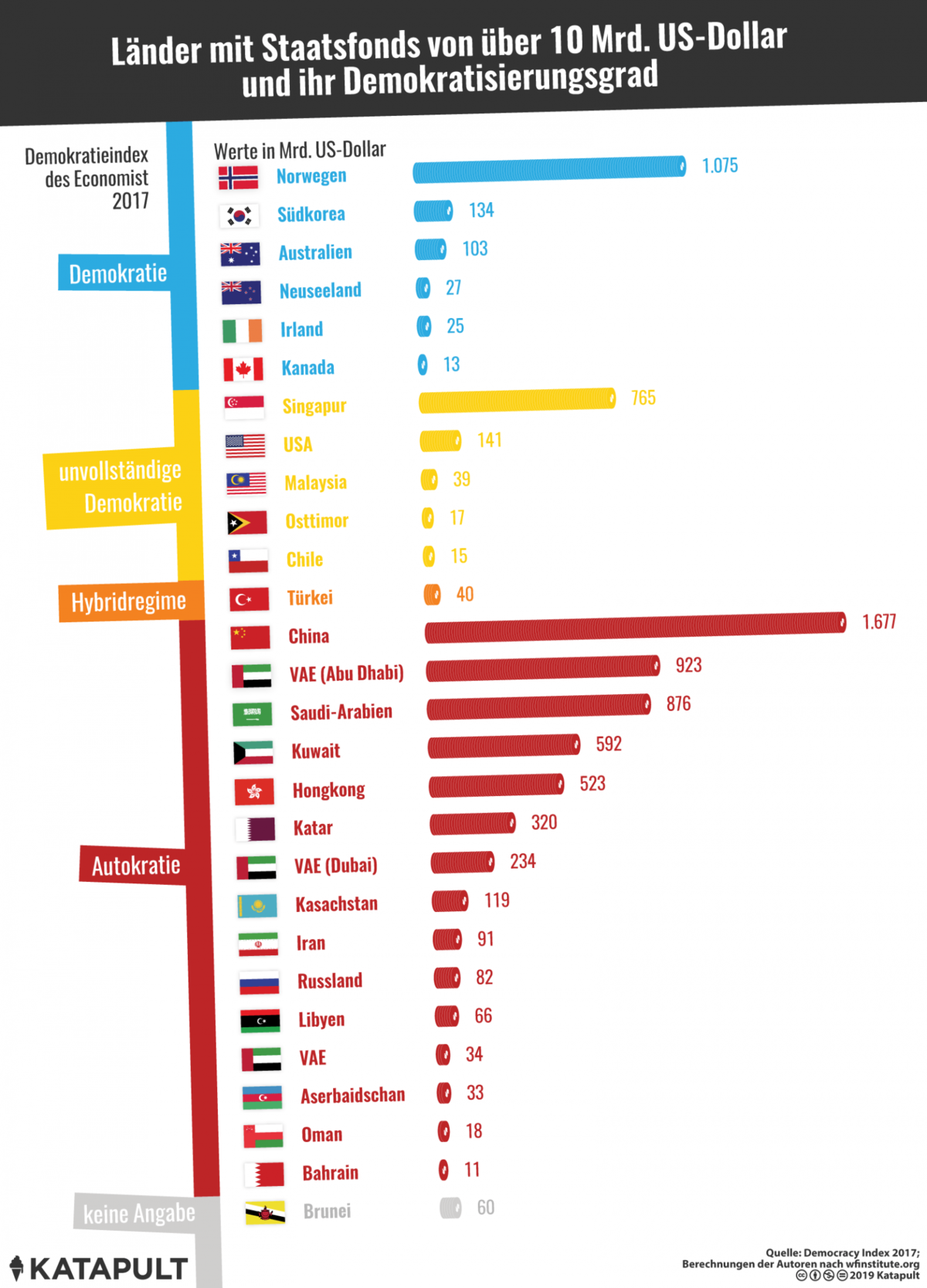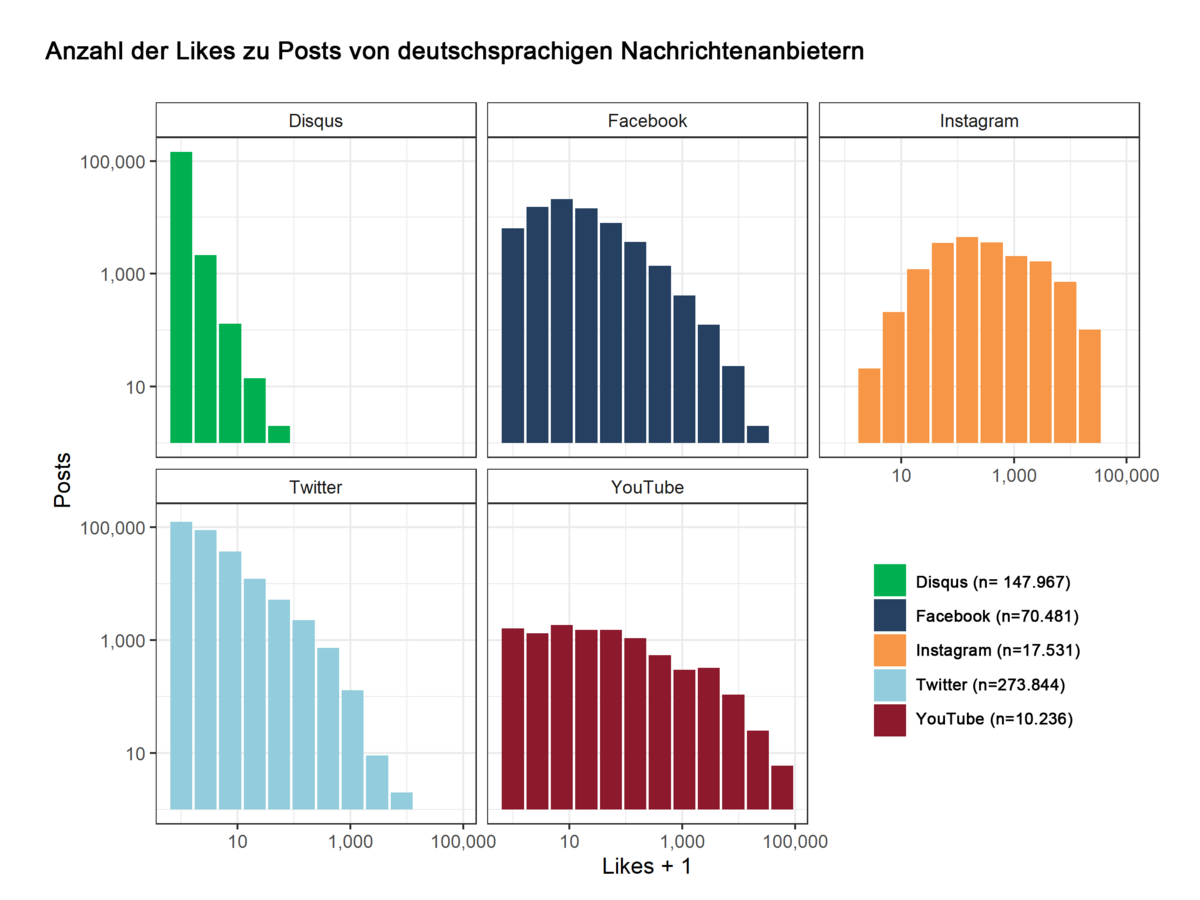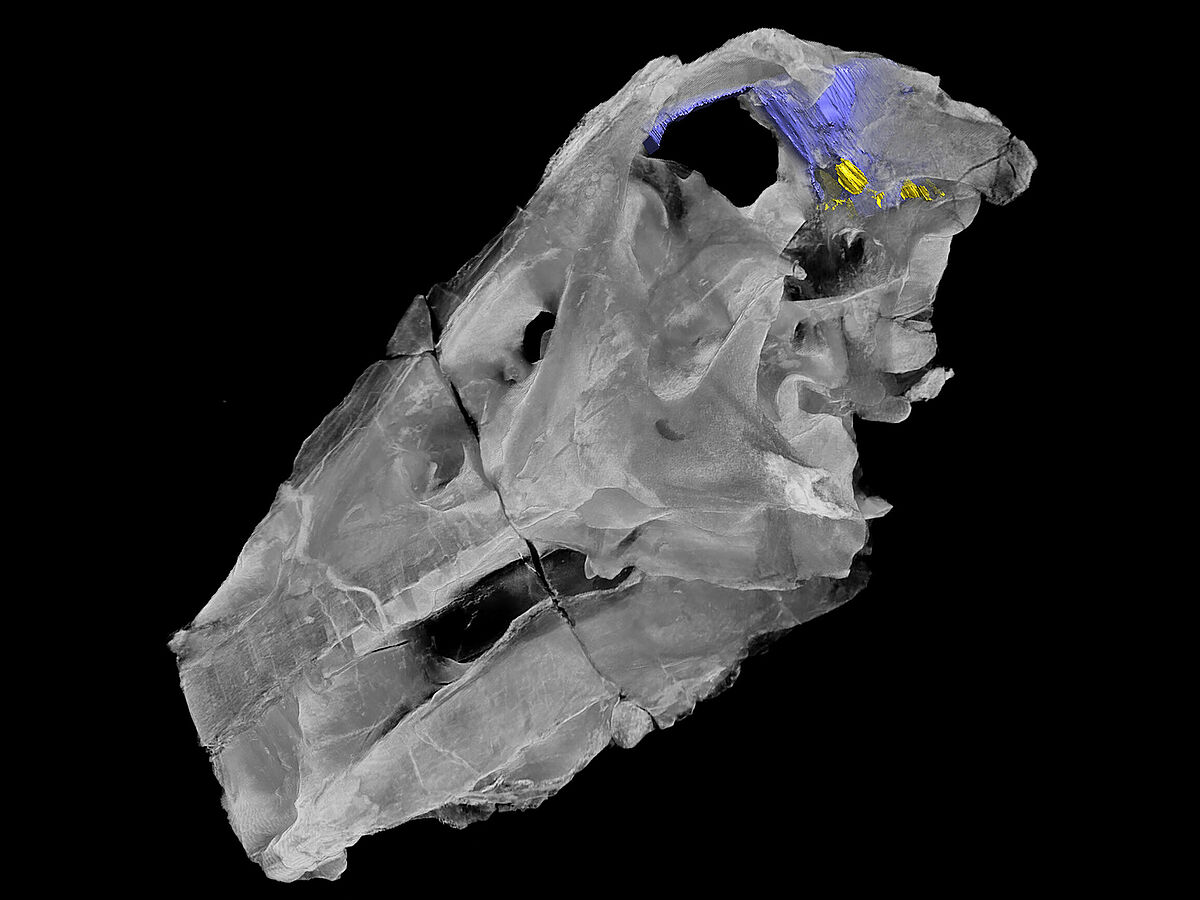Fakt der Woche
Mit dem „Fakt der Woche“ präsentieren wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Universität Greifswald. Damit möchten wir mehr Aufmerksamkeit für die vielfältigen Forschungsbereiche unserer Universität generieren, Interesse an ihnen wecken und ein Zeichen für wissenschaftliche Erkenntnisse setzen. Der „Fakt der Woche“ erscheint ebenso auf Instagram, Facebook und Twitter.
Digitale Herbarien
Einmalige Pflanzenableger weltweit verfügbar machen
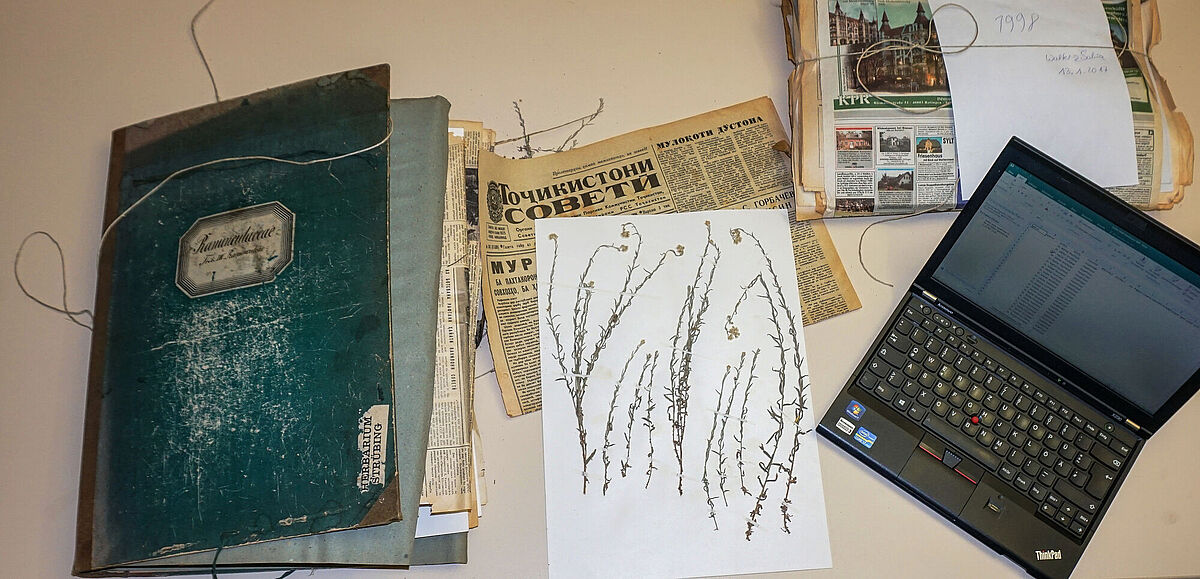

Warum sind Digitale Herbarien wichtig?
Herbarien sind Archive getrockneter und sorgfältig dokumentierter Pflanzen. Sie bilden das Archiv der Flora einer Region oder eines Landesund bieten damit jeder interessierten oder fachlich befassten Person die Möglichkeit, sich über die aktuelle oder vergangene Verbreitung von Pflanzen bis in das kleinste morphologische Detail zu informieren. Sie sind damit etwa vergleichbar mit Eisbohrkernen aus der Arktis oder Spektralaufnahmen des Universums.
Digitalisierte Herbarbelege geben allumfassende Informationen unabhängig von Raum und Zeit. Unterhalb der Pflanze befindet sich die Legende mit Namen, Fundort und Finder*in der Pflanze. Die Farbkarte dient zur Eichung des Farbwertes und das Lineal zur Größeneinordnung. Im weißen Umschlag sind Pflanzensamen. Der Strichcode mit Kennung im oberen Bereich garantiert eine eindeutige Zuordnung und Auffindbarkeit des Belegs. Das Großartige an dieser Dokumentation ist jedoch die Digitalisierung. Im Online-Herbarium kann man schnell und nah ohne lange Ladezeiten hereinzoomen, um sich die kleinsten Details der Pflanze anschauen.
In einer global vernetzten Wissenschaftscommunity sind digitale Herbarien mit online verfügbaren Herbarbelegen nicht mehr weg zu denken. Auf diese Weise können die Daten mit weiteren Biodiversitäts- und Umweltdaten verbunden werden und zu neuem Wissen beitragen.
Welche Digitalen Herbarien zählen zu den größten der Welt?
Das Nationale Herbarium von UsbekistanTASH am Institut für Botanik der Akademie der Wissenschaften Usbekistans in Taschkent beherbergt die größte Sammlung von Herbarbelegen in Zentralasien. Es gehört zu den 100 größten Herbarien der Welt. Die Sammlung enthält mehr als 1,5 Millionen Pflanzenbelege, die in den vergangenen 180 Jahren in allen Regionen Zentralasiens gesammelt wurden. Dazu gehören viele Typus-Belege von herausragendem Wert, da auf solchen Belegen die Beschreibung und Nomenklatur von Organismen basiert. Die ersten digitalen Herbarbelege aus dem TASH wurden an die Global Biodiversity Information Facility GBIF übertragen. Die GBIF ist mit über 2 Milliarden Einträgen die weltweit umfassendste Biodiversitätsdatenbank, und steht Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt unter der creative commons Lizenz zur Verfügung.
Warum sind Wissenschaftskooperationen hierfür wertvoll?
Die Digitalisierung der Herbarbelege des TASH findet im Rahmen des Projektes „Virtual Flora of Central Asia – CAViF“ statt. Dabei haben Wissenschaftler*innen des Instituts für Botanik der Akademie der Wissenschaften Usbekistans, der Universität Greifswald und der Michael Succow Stiftung eng zusammengearbeitet und tragen damit entscheidend dazu bei, dass die Flora einer Region jeder interessierten Person bis in das kleinste morphologische Detail zugänglich gemacht wird.
Weitere Informationen
Typensammlung des Nationalen Herbariums von Usbekistan
Virtual Guide to the Flora of Uzbekistan
Ansprechtpartner
Michael Succow Stiftung
Jens Wunderlich
Leiter Schutzgebiete & Biosphäre
jens.wunderlichsuccow-stiftungde
Abbau von Kunststoffen
Abbau von Kunststoffen durch neu entwickelte Biokatalysatoren
Kunststoffe sind unentbehrlich für die Herstellung von Baumaterialien, elektrischen Isolierungen, Getränke- und Lebensmittelverpackungen, Textilien und vielen weiteren Anwendungen des täglichen Lebens. Leider hat die Massenproduktion von Plastik, vor allem für Verpackungen, weltweit zu einer enormen Plastikverschmutzung unserer Umwelt geführt. Für den vor allem für Getränkeflaschen häufig verwendeten Kunststoff PET (Polyethylenterephthalat) konnten bereits effiziente Recyclingverfahren unter Einsatz optimierter Enzyme entwickelt werden, um die Bausteine zur Herstellung von neuem PET ohne erneuten Einsatz von Erdöl zu erreichen [1].
Einem Team von Wissenschaftler*innen am Institut für Biochemie der Universität Greifswald in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Uwe Bornscheuer ist es nun erstmals – gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Covestro und Teams aus Leipzig und Irland – gelungen, neue Verfahren für den Abbau der Kunststoffe Polyurethan (PUR) [2] und Polyvinylalkohol (PVA) [3] zu entwickeln. Diese beiden Polymere machen rund acht Prozent der Kunststoffproduktion in Europa aus. Polyurethane werden zur Herstellung von Matratzen, Dämmstoffen, Thermoplasten (z. B. für Sportschuhe) und für Beschichtungen (Dichtungsmittel, Farben und Klebstoffe) verwendet. Für diese Stoffe gibt es bereits grundlegende chemische Verfahren, um diese abzubauen. Sie erfordern jedoch einen erheblichen Energieeinsatz, da hohe Temperaturen und Drücke nötig sind. Biotechnologische Verfahren unter Einsatz von Mikroorganismen oder Enzymen als natürliche Biokatalysatoren sind eine Alternative, da diese bei moderaten Temperaturen bis ca. 40°C und ohne Einsatz chemischer Reagenzien den Abbau der Plastikmoleküle und vor allem ein Recycling, also die Gewinnung der Bausteine zur Herstellung neuer Kunststoffe ermöglichen.
Nach einer einfachen chemischen Vorbehandlung ist es mit den neu identifizierten Enzymen Polyurethane in seine Bausteine zu zerlegen [2]. „Die Suche nach diesen speziellen Biokatalysatoren war sehr aufwändig und wir mussten ca. zwei Millionen Kandidaten durchmustern, um die ersten drei Enzyme zu finden, die nachweislich in der Lage sind, die spezielle Bindung in Polyurethan aufzubrechen“, beschreibt Doktorand Yannick Branson (Universität Greifswald) die Herausforderung dieses Projekts. „Mit dieser bahnbrechenden Entdeckung haben wir nun die Voraussetzung geschaffen, diese Biokatalysatoren durch Methoden des Protein-Engineerings weiter zu verbessern, um sie für ein industrielles Recycling von Polyurethan maßschneidern zu können“, führt Professor Bornscheuer weiter aus. „Mit Hilfe der neu identifizierten Enzyme kommen wir unserem Ziel einer vollständigen Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie ein Stück näher“, ergänzt Dr. Gernot Jäger, der das Kompetenzzentrum für Biotechnologie der Covestro (Leverkusen) leitet.
Polyvinylalkohole (PVA) haben vielseitige Eigenschaften und werden ebenfalls breit eingesetzt, z.B. bei der Beschichtung von Fasern und als Folien für Verpackungen. Für den Abbau von PVA gab es bislang ebenfalls keine ausgereiften Verfahren. Hier konnten die Forscher*innen um Professor Bornscheuer zusammen mit einem Polymer-Experten des University College Dublin (Irland) und Wissenschaftler*innen aus Leipzig ebenfalls die Grundlagen für ein biotechnologisches Verfahren entwickeln [3]. Der Abbau von PVA konnte hier durch die geschickte Kombination von drei verschiedenen Enzymen erzielt werden, die nach und nach das Polymer so verändern, bis Bruchstücke entstehen, die stofflich verwertet werden können.
Mit diesen Verfahren wurden somit die Voraussetzungen geschaffen, beide Kunststoffe ressourcenschonend zu verwerten und umweltfreundliche Verfahren zu deren Recycling zu entwickeln, um das weltweite Problem des Plastikmülls für diese industriell in großen Mengen hergestellten synthetischen Polymere zu verringern.
Quellen und weitere Informationen
[1] Wei, R., von Haugwitz, G., Pfaff, L., Mican, J., Badenhorst, C.P.S, Liu, W., Weber, G., Austin, H., Bednar, D., Damborsky, J., Bornscheuer, U.T. (2022), Mechanism-based design of efficient PET hydrolases, ACS Catal., 12, 3382-3396, https://doi.org/10.1021/acscatal.1c05856.
[2] Urethanases for the enzymatic hydrolysis of low molecular weight carbamates and the recycling of polyurethanes, Angew. Chem. Int. Ed., 62, e202216220, https://doi.org/10.1002/anie.202216962; Urethanasen für die enzymatische Hydrolyse niedermolekularer Carbamate und das Recycling von Polyurethanen (auf Deutsch), Angew. Chem., 135, e202216220, https://doi.org/10.1002/ange.202216962.
[3] Synthesis of modified poly(vinyl alcohol)s and their degradation using an enzymatic cascade, Angew. Chem. Int. Ed., 62, e202216220, https://doi.org/10.1002/anie.202216220; Synthese modifizierter Poly(vinylalkohole) und deren Abbau durch eine Enzymkaskade, Angew. Chem., 135, e202216220 (auf Deutsch), https://doi.org/10.1002/ange.202216220
Ansprechpartner
Prof. Dr. Uwe Bornscheuer
Institut für Biochemie
uwe.bornscheueruni-greifswaldde
http://biotech.uni-greifswald.de
Europasaurus holgeri
Dinosaurier aus Norddeutschland: Inselzwerge und ihre Innenohren
Vor ungefähr 154 Millionen Jahren standen weite Teile des heutigen Europas unter Wasser. Damals wurde die Erde noch von Dinosauriern bevölkert. Einer von ihnen, Europasaurusholgeri, gehörte zu den langhalsigen Pflanzenfressern und gilt als fossiles Beispiel für Inselverzwergung. Reste des Hinterhauptes geben nun Aufschluss über die Lebensweise dieses ausgestorbenen Tieres.
Schädel und ihre Bedeutung
Wie bei allen Wirbeltieren saßen auch bei Dinosauriern wesentliche Sinnesorgane am Kopf: der Seh- und Geruchssinn, das Gehör sowie der Gleichgewichts- und Geschmackssinn. Darüber hinaus ist natürlich auch das Gehirn im Schädel situiert. Das alles verleiht Schädelmaterial eine bemerkenswerte Fülle von Hinweisen auf (paläo)biologische Aspekte, wie den Lebensstil, eines bestimmten Tieres. Die Hohlräume, die einst das Gehirn, die Innenohren mit dem Gleichgewichtsorgan und weitere derartige Strukturen beherbergten, können mit digitalen Ausgüssen nachempfunden und untersucht werden.
Der Zwerg aus dem Harz
Von vielen Dinosaurierarten sind solche Ausgüsse, die mithilfe von Computertomographie-Daten kreiert wurden, bereits bekannt. Der verzwergte Langhalsdinosaurier (Sauropode) Europasaurus gehörte bis vor kurzem nicht dazu. Fossilien von Europasaurus stammen aus dem niedersächsischen Teil des Harznordrandes bei Oker. Dieses Tier lebte vor etwa 154 Millionen Jahren, also im späten Jura. Während sein berühmter Verwandter aus Nordamerika, Brachiosaurus, mit etwa 15 Metern Höhe allerdings etwa dreimal so hoch war wie heutige Giraffen, erreichte Europasaurus „nur“ eine Höhe von etwa 3 Metern. Vermutlich stellt Europasaurus damit ein fossiles Beispiel für das Phänomen der Inselverzwergung dar, was u.a. durch die Isolation auf einer – im Vergleich zum Festland – relativ kleinen Landfläche mit begrenztem Nahrungsangebot erklärt werden kann. Der Forscher Marco Schade und seine Kolleginnen und Kollegen wollten mehr über diesen interessanten Inselbewohner in Erfahrung bringen und untersuchten dazu fossiles Hirnschädelmaterial dieser Art. Dafür standen den Wissenschaftlern versteinerte Knochen zur Verfügung, die Teile des Innenohres beherbergten und von unterschiedlich alten Individuen stammten.
Neue Technik, alte Knochen
Durch Röntgen-Computertomographie konnten auch kleinste Hohlräume, in denen sich beim lebenden Tier die Innenohren, Blutgefäße und Hirnnerven befanden, rekonstruiert, beschrieben und mit Verwandten verglichen und so kontextualisiert werden. So wurde ersichtlich, dass schon die Innenohren sehr kleiner Individuen beinahe so groß und so geformt waren wie bei ausgewachsenen Tieren. Da die Innenohren für das Hören und den Gleichgewichtssinn zuständig sind, legen diese Ergebnisse nahe, dass bereits sehr kleine Europasaurier „gut zu Fuß“ waren, womöglich sehr früh das Nest verließen und der Herde folgten, um Nahrung zu suchen; ganz ähnlich wie heutige Hühner. Außerdem war der Bereich des Innenohres, der für das Hören verantwortlich ist, bei Europasaurus relativ groß, was eine ausgeprägte innerartliche Kommunikation über Geräusche wahrscheinlich macht.
Die Ergebnisse von Marco Schade sowie den beteiligten Kolleginnen und Kollegen tragen zur bekannten Diversität der Hirnschädelanatomie ausgestorbener Dinosaurier bei und unterstützen unabhängige Hinweise darauf, dass die langhalsigen Sauropoden Herdentiere mit Sozialverhalten waren, die bemerkenswerte Wachstumsgeschwindigkeiten realisierten und sehr schnell recht eigenständig gewesen sein dürften. Abgesehen von der Körpergröße unterschied Europasaurus vermutlich nicht allzu viel von seinen gigantischen Verwandten auf dem Festland.
Ansprechpartner an der Universität Greifswald
Marco Schade
Institut für Geographie und Geologie
marco.schadestud.uni-greifswaldde
Altersbilder
Positive Altersbilder: Wie sie unsere Gesundheit beeinflussen können
Was sind Altersbilder?
Unsere gesellschaftlichen und individuellen Sichtweisen auf das Älterwerden und alt sein werden auch als „Altersbilder“ bezeichnet. Zu solchen Altersbildern zählen die vorherrschenden Altersstereotype ebenso wie unsere Vorstellungen vom eigenen Älterwerden. Beide Formen von Altersbildern sind eng miteinander verbunden, da eigene Erfahrungen mit dem Älterwerden vor dem Hintergrund der von Kindheit an gelernten gesellschaftlichen Altersstereotype gemacht werden. Altersbilder sind nicht einfach positiv oder negativ. Vielmehr denken wir oftmals je nach Lebensbereich an positive Aspekte des Älterwerdens, zum Beispiel an Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung wie dem Verfolgen von persönlichen Zielen, dem Erlernen von neuen Dingen; zugleich verbinden wir mit dem Älterwerden häufig auch Verluste, z. B. gesundheitliche oder soziale Verluste.
Welche Rolle spielen Altersbilder dafür, wie lange wir leben?
Seit über 20 Jahren zeigt eine stetig steigende Zahl an umfangreichen Studien, die über lange Zeiträume von mehreren Jahrzehnten hinweg die Bevölkerung befragt und untersucht haben, dass unsere Altersbilder eine Rolle dafür spielen, wie gesund wir leben. Internationale Studien zeigen dabei übereinstimmend: Unser Denken, unsere Erwartungen und bisherigen Erfahrungen mit dem eigenen Älterwerden können zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Menschen, die mit dem Älterwerden Verluste verbinden, haben in den folgenden Jahren eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Verluste zu erleben; gewinnbezogene Altersbilder tragen demgegenüber zu gesünderem Altern bei. Positive Altersbilder sind jedoch nicht gleichzusetzen mit anderen psychischen Ressourcen wie z. B. einem höheren Optimismus. Vielmehr haben Vorstellungen vom eigenen Älterwerden über solche psychischen Ressourcen hinausgehenden Erklärungswert für die Gesundheit, wie verschiedene Studien zeigen konnten.
In einer kürzlich erschienenen Studie untersuchte das Wissenschaftliche Netzwerk Altersbilder mit Daten einer umfangreichen, bevölkerungsrepräsentativen Studie aus Deutschland (Deutscher Alterssurvey), ob Altersbilder nicht nur zu Gesundheit, sondern auch zu Langlebigkeit beitragen. Ausgangspunkt dieser Studie war eine US-amerikanische Vorgängerstudie, die vor rund 20 Jahren diesen Zusammenhang nachweisen konnte. Die deutsche Studie beruhte auf 2400 Personen, die im Jahr 1996 erstmals zu ihren Altersbildern befragt wurden. Sie waren damals zwischen 40 und 85 Jahre alt. Über die folgenden 23 Jahre wurde für alle dokumentiert, wer weiterhin lebte und wer wann verstarb – insgesamt verstarben 871 Personen. Wie bereits in der Vorgängeruntersuchung zeigte sich, dass Menschen mit positiven Altersbildern deutlich länger lebten. Im Gegensatz zur amerikanischen Untersuchung jedoch, in der nur ein einziges Altersbild betrachtet wurde, konnten in der deutschen Studie verschiedene Altersbilder in ihrer Rolle für die Langlebigkeit miteinander verglichen werden. Dabei zeigte sich: Verbinden Menschen mit dem Älterwerden soziale Verluste, geht das nicht mit kürzerer Lebenszeit einher und auch Altersbilder die sich auf körperliche Verluste beziehen, sind nicht entscheidend für die Langlebigkeit. Als bedeutsam erweisen sich jedoch insbesondere gewinnorientierte Altersbilder: Menschen, die das Älterwerden als Entwicklungsprozess sehen, leben im Durchschnitt 13 Jahre länger [1].
Warum leben Menschen mit positiven Altersbildern länger?
In den letzten Jahren hat die Forschung zunehmend damit begonnen, besser zu verstehen, welche Mechanismen für diesen Effekt von Altersbildern auf Gesundheit und Langlebigkeit verantwortlich sind, auch wenn noch viele Fragen offen sind [2].
Drei Wirkmechanismen lassen sich dabei unterscheiden: physiologische, verhaltensbezogene und psychologische. (1) In Bezug auf physiologische Mechanismen gibt es Hinweise darauf, dass eine positive Sicht auf das eigene Älterwerden zu einem geringeren Niveau von C-reaktivem Protein, einem Biomarker für chronische entzündliche Prozesse, beiträgt und dies in der Folge höhere Langlebigkeit vorhersagen kann. (2) Altersbilder können zudem gesundheitsrelevante Verhaltensweisen beeinflussen und auf diesem Weg eine Wirkung auf die Gesundheit entfalten. Deutlich wird dies beispielsweise anhand von Befunden zu körperlicher Aktivität. Haben ältere Menschen eine negativere Sicht auf das Älterwerden, sind sie deutlich seltener körperlich aktiv als Personen mit einer positiveren Sicht. (3) Schließlich können psychologische Mechanismen dazu beitragen, dass Altersbilder eine Wirkung auf die Gesundheit entfalten. Dazu zählen unter anderem Attributionen (Ursachenzuschreibungen). So konnte beispielsweise eine Studie zeigen [3], dass ältere Menschen, die ihr Alter als Ursache ihrer chronischen Erkrankung (z. B. Diabetes, Krebs, Arthritis) erachteten, weniger für ihre Gesundheit taten und eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, in den folgenden zwei Jahren zu versterben als Personen, die andere Gründe für ihre Erkrankung (zum Beispiel ihren Lebensstil) heranzogen.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?
Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen haben den Zeitraum der Jahre 2021–2030 zur Dekade des gesunden Alterns erklärt. In diesem Zusammenhang wurde die Bekämpfung von negativen Altersbildern und Altersdiskriminierung zu einer zentralen Aufgabe erklärt. Der demographische Wandel schreitet voran, schon bald wird die große Gruppe der sogenannten Babyboomer in die nachberufliche Lebensphase eintreten. Gesellschaftlich benötigen wir eine größere Aufmerksamkeit dafür, wie stark unser Denken, Verhalten und unsere Sprache durch negative Altersbilder geprägt sind. Unser Wissen über das Älterwerden und Altsein ist teilweise verzerrt und manche Erfahrungen werden verallgemeinert. Dabei zeigt sich der Alternsprozess so individuell und vielfältig wie das Leben selbst. Es ist wichtig, vermeintliches Wissen zu hinterfragen, die Gesellschaft rund um das Thema Altwerden und Altsein zu informieren und für Altersbilder zu sensibilisieren. Persönlich kann Jede*r im Alltag auf eigene Denk- und Verhaltensmuster achten und diese gezielt durchbrechen, indem man sich folgende Fragen stellt: Wann erkläre ich bestimmte Dinge mit dem Alter einer Person (bzw. mit meinem eigenen Alter)? Welche alternativen Erklärungen außer dem Alter könnte es geben?
Quelle und weitere Informationen
[1] Wurm, S., & Schäfer, S. K. (2022). Gain- But Not Loss-Related Self-Perceptions of Aging Predict Mortality Over a Period of 23 Years: A Multidimensional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 123(3), 636-652. doi.org/10.1037/pspp0000412
[2] Wurm, S., Blawert, A., & Schäfer, S. K. (2022). The Importance of Views on Aging in the Context of Medical Conditions. In Y. Palgi, A. Shrira, & M. Diehl (Eds.), Subjective Views of Aging: Theory, Research, and Practice (pp. 289-307). Springer. doi.org/10.1007/978-3-031-11073-3
[3] Stewart, T. L., Chipperfield, J. G., Perry, R. P., & Weiner, B. (2012). Attributing illness to ‘old age:’ Consequences of a self-directed stereotype for health and mortality [Article]. Psychology & Health, 27(8), 881-897. doi.org/10.1080/08870446.2011.630735
Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald
Prof. Dr. Susanne Wurm
Abteilung für Präventionsforschung und Sozialmedizin, Institut für Community Medicine, Universitätsmedizin Greifswald
susanne.wurmmed.uni-greifswaldde
Covid-19-Studie
COVIDKID: COVID-19-Studie bei Kindern und Jugendlichen in Vorpommern
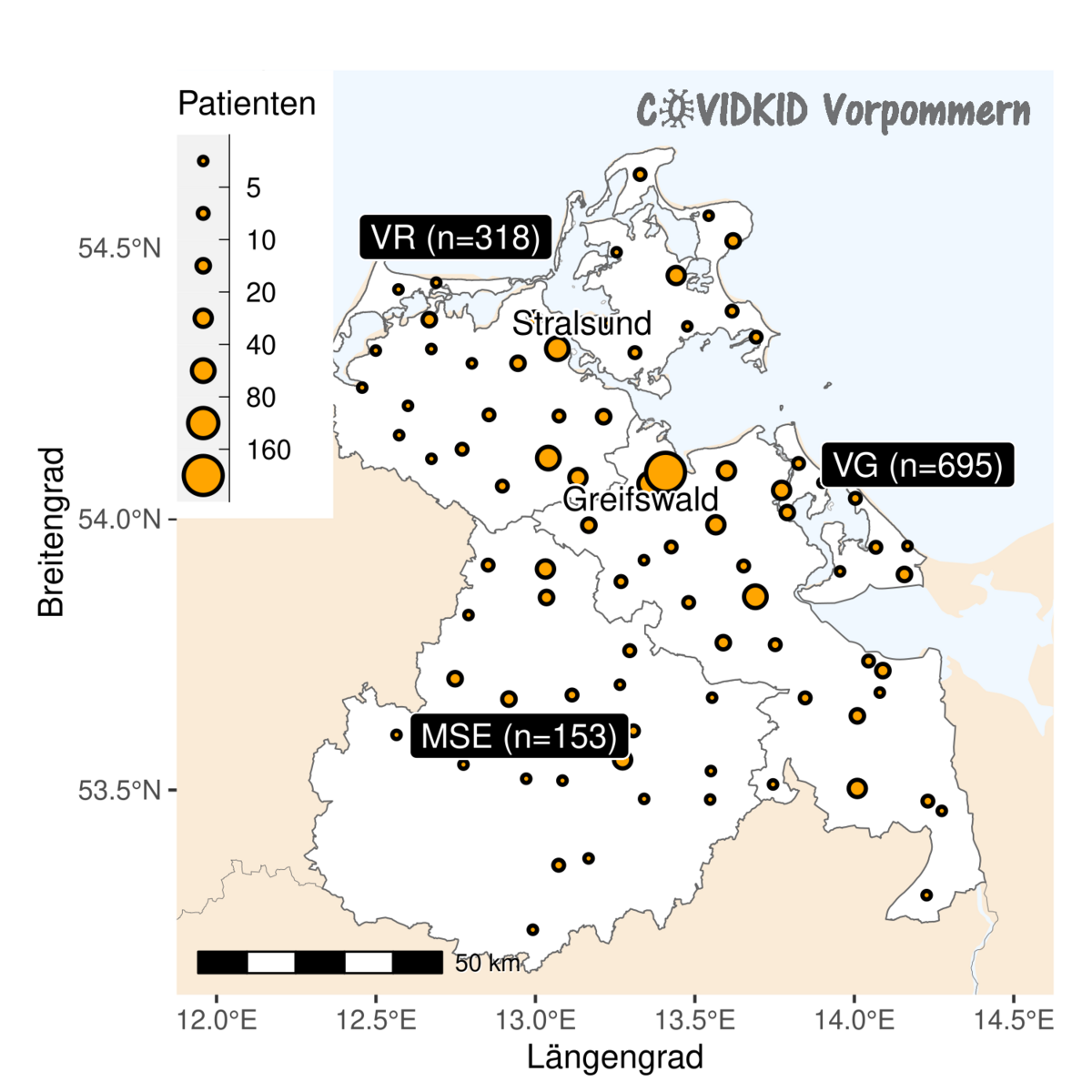
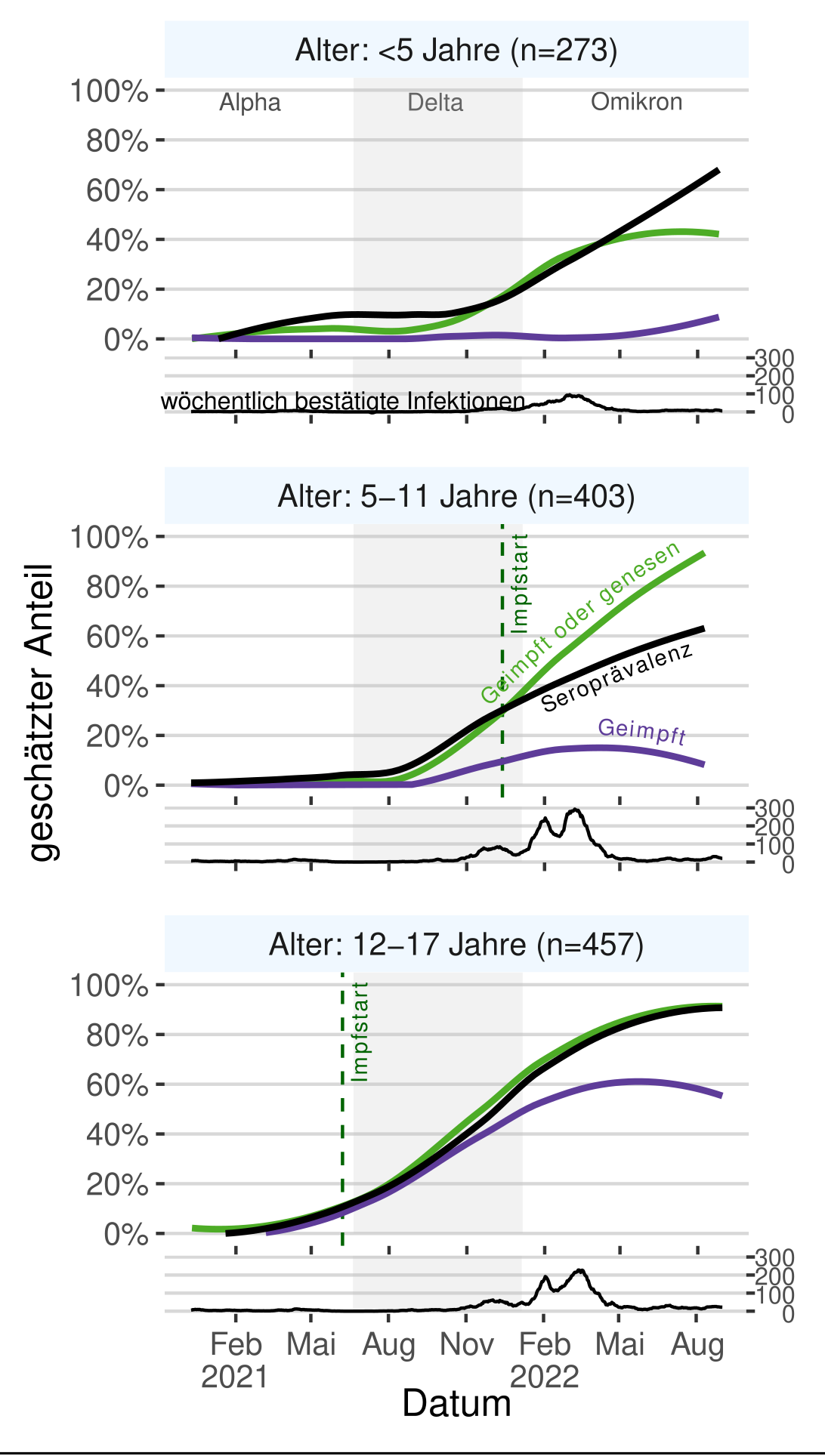
Seit fast drei Jahren kämpfen wir uns alle gemeinsam durch die Corona-Pandemie. Ein wichtiges Thema ist dabei die Frage nach Infektionen und deren Verbreitung unter Kindern und Jugendlichen in Vorpommern. Dazu startete an der Universitätsmedizin Greifswald Ende 2020 die COVIDKID-Studie, die vom Landesministerium für Soziales, Gesundheit und Sport unterstützt wurde.
Untersucht wurden für die Studie Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum vollendeten 17. Lebensjahr auf Antikörper, die eine durchgemachte Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus anzeigen. Dafür haben die Wissenschaftler*innen um Prof. Dr. Almut Meyer-Bahlburg in Zusammenarbeit mit den Kinderkliniken in Stralsund, Bergen (Rügen), Demmin, Pasewalk und Anklam sowie zwei Kinderarztpraxen aus Greifswald mehr als 1000 Blutproben gesammelt und untersucht.
Da Kinder nach einer Infektion häufig gar keine bis moderate Symptome zeigen, ist gerade die Frage nach der Dunkelziffer von großem Interesse. Zudem wurde von den teilnehmenden Familien ein Fragebogen ausgefüllt. So war es im Verlauf der Studie auch möglich, etwas über die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen zu erfahren. Die statistische Auswertung erfolgt in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Lars Kaderali im Institut für Bioinformatik der Universitätsmedizin Greifswald.
Unsere bisherigen Ergebnisse …
Von Ende 2020 bis August 2022 wurden 1166 Patient*innen in die Studie eingeschlossen. Eine Übersicht über die Wohnorte der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist in Abbildung 1 dargestellt.
Bis Ende August waren je nach Altersgruppe 60 bis 90 Prozent der Kinder seropositiv, d.h. im Blut waren virusspezifische Antikörper nachweisbar. Im Fragebogen wurden neben sozio-demographischen Merkmalen auch Informationen zu abgelaufenen Infektionen und Impfungen erfasst. Eine graphische Zusammenfassung der modellierten anamnestisch erhobenen Impf- und Genesenenquoten (grüne Linie) gemeinsam mit der tatsächlich gemessenen Seroprävalenz (graue Linie) ist in Abbildung 2 dargestellt. Es zeigt sich, dass Ende August 2022 über 90 Prozent der Jugendlichen geimpft oder genesen sind. Bei den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren geben zwar fast 90 Prozent an, dass sie entweder geimpft oder genesen sind; Antikörper sind aber nur bei etwa 60 Prozent nachweisbar. In der jüngsten Gruppe (<5 Jahre) hingegen weisen wir bei mehr Kindern Antikörpern nach, als bei der Frage nach einer Infektion zu erwarten wäre. Damit liegt hier im Vergleich zu den anderen beiden Altersgruppen eine relativ hohe Dunkelziffer an Infektion vor, d.h. die Kinder haben eine Infektion durchgemacht, ohne dass es bemerkt oder diagnostiziert wurde.
Wie geht es mit diesem Projekt weiter?
Geplant ist die Fortsetzung der Probensammlung noch bis Ende März 2023. So soll abschließend ein Bild von der Seroprävalenz für SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen entstehen, unabhängig davon, ob dies durch eine Infektion oder eine Impfung erreicht wurde. Zudem ist geplant, die Proben auf die verschiedenen Corona-Varianten zu untersuchen (Alpha, Delta, Omikron-Subtypen). Das ist mit Hilfe moderner Techniken möglich und soll gemeinsam mit einem anderen Institut der Universitätsmedizin Greifswald untersucht werden. Gerade die stark ansteckenden Omikron-Varianten, die aktuell in Deutschland zirkulieren, haben für die Forscher*innen das Potential, viel über das Virus und seine Infektiosität zu lernen.
Im Rahmen der weiteren Auswertung sollen zudem anhand der im Fragebogen erhobenen sozio-demographischen Merkmale Risikofaktoren für eine Infektion identifiziert werden.
Auch wenn die eigentliche Corona-Pandemie nun hoffentlich bald vorüber ist, wird uns das Virus wohl noch länger beschäftigen. Bei einigen Patientinnen und Patienten treten nach einer Infektion langfristig Symptome, insbesondere Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Konzentrationsstörungen und vieles mehr auf, die unter dem Begriff Long-COVID zusammengefasst werden. Die Studienlage für Long-COVID ist generell noch sehr dünn. Die meisten Studien beschäftigen sich mit Erwachsenen, zu Kindern und Heranwachsenden sind kaum Informationen verfügbar. Umso wichtiger ist es, sich auch mit dieser „neuen“ Erkrankung zu beschäftigen, um den Kindern und ihren Familien schnell kompetente Hilfe zu leisten.
Plasmamedizin
Was ist kaltes physikalisches Plasma und welche medizinischen Behandlungen sind damit möglich?
Was ist kaltes physikalisches Plasma?
Plasma ist als sogenannter vierter Aggregatzustand der Materie, ein ionisiertes Gas, und wird üblicherweise durch Erhitzung auf mehrere tausend Grad Celsius erzeugt. Kaltes atmosphärisches Plasma hingegen ist ein teilweise ionisiertes Gas, das Körpertemperatur besitzt und bei Atmosphärendruck auf der Erde produziert werden kann. Kaltes Plasma besteht aus einem reaktiven Mix aus Elektronen, Ionen, angeregten Atomen und Molekülen, reaktiven Spezies (wie z.B. O3, NO, NO2, etc.), UV-Strahlung und Wärme, welcher sehr effektiv Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, Viren oder Sporen zerstört.
Welchen Patient*innen kann eine plasmamedizinische Behandlung empfohlen werden?
In der Universitätsmedizin Greifswald spielt die Behandlung mit präzise und berührungslos anwendbarem Jetplasma besonders rekonstruktiven Chirurgie eine Rolle. Laut der ärztlichen Leitlinie „Rationaler therapeutischer Einsatz von kaltem physikalischem Plasma“, nachzulesen im AWMF-Register 007-107, eignen sich besonders Wunden, die durch ausbleibende Abheilung oder durch Infektion zu Problemwunden geworden sind, zur Plasmabehandlung.
Welche Erkrankungen können mit kaltem Plasma behandelt werden?
Die Plasmabehandlung zeigt gute Erfolge bei der Behandlung von akuten und chronischen infizierten Wunden aller Körperregionen. Aber auch entzündlich bedingte Haut- und Schleimhauterkrankungen sowie Wundheilungsstörungen nach operativen Eingriffen sprechen gut auf die die Behandlung mit atmosphärischen Kaltplasma an.
Wie ist hier der Forschungsstand?
Mit der zufallsauswahlbasierten klinische Studien von Stratmann et al. (2020), Miropur et al. (2020) und Strohal et al. (2022), ist die Behandlung von komplizierten Wunden mit Jetplasma-Medizingeräten auf dem aktuell höchsten Level der evidenz-basierten Medizin angelangt. Dank zahlreicher publizierter Forschungsarbeiten zur Wirkung und Sicherheit der Plasma-Anwendung ist bekannt, dass unter den vielfältigen Plasma-Wirkprinzipien vor allem chemisch-reaktive Moleküle, sogenannte freie Radikale, die Effekte vermitteln. Diese sind übrigens ähnlich denen, die auch der Körper zur Abwehr von Krankheitserregern nutzt.
Ist Plasmamedizin inzwischen Lehrbuchwissen für Ärzte und Ärztinnen?
Das Standardlehrbuch Comprehensive Clinical Plasma Medicine, herausgegeben im Greifswalder Plasmacluster und erschienen im Springer Verlag, geht gerade in die zweite Auflage und gibt ebenso wie das 2022 erschienene Textbook of Good Clinical Practice in Cold Plasma Therapy einen umfassenden Überblick zum Thema Plasmamedizin.
Plasmamedizin, die rationale therapeutische Anwendung von kaltem physikalischen Plasma ist in den letzten Jahren zu einem Aushängeschild der Greifswalder Unimedizin geworden. Wieso?
Zum Greifswalder Plasmamedizin-Cluster gehören die Universitätsmedizin mit ihrer klinischen Forschung und Anwendung, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) als Zentrum der anwendungsorientierten Grundlagenforschung (ZIK plasmatis) und die Plasmatechnologie-Entwicklung (INP) und dessen Firmenausgründung, die neoplas med GmbH, als einer der Weltmarktführer für Jetplasma-Medizingeräte. Als der japanische Technologie-Konzern NGK mit einem globalen Jahresumsatz von: 3,8 Milliarden Euro (2021/22) für seine Plasmamedizinpläne einen strategischen Partner suchte, hat er sich weltweit umgeschaut und ihn dann im Greifswalder Plasma-Cluster gefunden. Der Vertrag mit der neoplas med GmbH ist im Juli 2022 unterzeichnet worden.
Wo kann ich mich informieren und beraten lassen?
In der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen (Direktorin Prof. Dr. Dr. Andrea Rau, Kontakt Direktionssekretariat: Telefon 03834 86 7160, gundula.fasoldmed.uni-greifswaldde).
Literatur zum Thema:
[1] Stratmann, B., Costea, T. C., Nolte, C., Hiller, J., Schmidt, J., Reindel, J., Masur, K., Motz, W., Timm, J., Kerner, W., & Tschoepe, D. (2020). Effect of Cold Atmospheric Plasma Therapy vs Standard Therapy Placebo on Wound Healing in Patients With Diabetic Foot Ulcers: A Randomized Clinical Trial. JAMA network open, 3(7), e2010411. doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.10411.
[2] Mirpour, S., Fathollah, S., Mansouri, P., Larijani, B., Ghoranneviss, M., Mohajeri Tehrani, M., & Amini, M. R. (2020). Cold atmospheric plasma as an effective method to treat diabetic foot ulcers: A randomized clinical trial. Scientific reports, 10(1), 10440. doi.org/10.1038/s41598-020-67232-x.
[3] Strohal, R., Dietrich, S., Mittlböck, M., & Hämmerle, G. (2022). Chronic wounds treated with cold atmospheric plasmajet versus best practice wound dressings: a multicenter, randomized, non-inferiority trial. Scientific reports, 12(1), 3645. doi.org/10.1038/s41598-022-07333-x.
[4] Bekeschus, S., von Woedtke, T., Emmert, S., & Schmidt, A. (2021). Medical gas plasma-stimulated wound healing: Evidence and mechanisms. Redox biology, 46, 102116. doi.org/10.1016/j.redox.2021.102116.
Politik und Demokratie
Die Wähler*innen der AfD: abgeschottet und unerreichbar?
Die AfD, gegründet 2013, hat sich im Parteiensystem der Bundesrepublik etabliert. Die politikwissenschaftliche Forschung hat sich der neuen Partei rasch zugewendet. Eine der am meisten diskutierten Fragen besteht darin, wer die AfD wählt und warum. Aufgrund ihrer besonderen ideologischen Ausrichtung stellt die AfD zugleich eine Herausforderung für die Parteien des politischen Mainstreams dar. Daher befasst sich ein anderer Forschungsstrang mit den Gegenstrategien der etablierten Parteien. Eine Studie [1] von PD Dr. Marcel Lewandowsky (Vertretungsprofessor für Vergleichende Regierungslehre, Universität Greifswald) und PD Dr. Aiko Wagner (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) publizierte im Fachjournal Representation verbindet beide Forschungsstränge. Sie verwendet Daten der German Longitudinal Election Study (GLES) und nutzt das Maß der electoral availability, um zu messen, inwiefern Wähler*innen der AfD grundsätzlich bereit sind, eine andere Partei als die AfD zu wählen. Zugleich analysiert sie, durch welche Einstellungsmerkmale die availability der AfD-Wähler*innen erklärt werden kann. Aus diesen Befunden kann abgeleitet werden, inwiefern themenorientierte Strategien – etwa eine inhaltliche Annäherung an die AfD – sich für die anderen Parteien auszahlen könnte.
Wer wählt die AfD?
Viele Studien können zeigen, dass die Wahl der AfD durch bestimmte Einstellungsmerkmale der Bürger*innen erklärt werden kann. Erstens nehmen die Wähler*innen der AfD eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber Migration ein. Zweitens verfügen sie über ein besonderes demokratiepolitisches Profil. Das bedeutet: Auf der einen Seite sind sie mit dem gegenwärtigen Zustand der Demokratie unzufrieden und lehnen die gegenwärtigen politischen Eliten ab. Auf der anderen Seite befürworten sie eine Demokratieform, in der das Volk uneingeschränkt souverän ist und der Wille der von ihnen selbst wahrgenommenen Mehrheit auch gegen Minderheiten durchgesetzt wird. Die Kombination beider Attribute bezeichnet man in der Forschung als „populistische Einstellungen“.
Wie stehen die AfD-Wähler*innen zu den anderen Parteien?
Die Studie zeigt, dass die AfD-Unterstützer*innen von allen Wähler*innen in Deutschland mit Abstand die geringste availability aufweisen. Sie sind also am wenigsten bereit, eine andere Partei als die von ihnen präferierte zu wählen. Das bedeutet, dass sie auf dem Wählermarkt relativ abgeschottet sind. Die geringe availability der AfD-Wähler*innen kann durch drei Faktoren erklärt werden. Erstens spielt die von den Wähler*innen wahrgenommene thematische Distanz zwischen ihren eigenen Themenpositionen und denen der Parteien eine Rolle. Das trifft besonders auf die Migrationspolitik zu. Zweitens lässt sich eine geringe availability durch populistische Einstellungen erklären, die bei einem Großteil der AfD-Unterstützer*innen stark ausgeprägt sind. Und drittens hängen die Effekte beider Faktoren systematisch miteinander zusammen: Je stärker populistische Einstellungen ausgeprägt sind, desto geringer ist der positionale Effekt. Für diejenigen Wähler*innen, die populistisch eingestellt sind, spielen Einstellungen zu Migration oder Wirtschaftspolitik keine Rolle für deren availability.
Welche Konsequenzen haben die Befunde für den Parteienwettbewerb?
Aus Sicht der anderen Parteien ist es auf Basis der Ergebnisse dieser Studie nicht rational, sich den Positionen der AfD anzunähern, um deren Wähler*innen zurückzugewinnen. Das liegt zum einen daran, dass die AfD-Wähler*innen eine große inhaltliche Kluft zu den etablierten Parteien wahrnehmen. Zum anderen haben populistische Einstellungen der AfD-Wähler*innen einen hohen Einfluss auf deren alleinige Präferenz für die AfD. Das bedeutet für die Parteien des politischen Mainstreams, dass sie sich nicht nur thematisch annähern, sondern auch das populistische Profil der AfD imitieren müssten. Zudem sind AfD-Wähler*innen mit starken populistischen Einstellungen – und das trifft auf den Großteil zu –auch durch ein thematisches Heranrücken der anderen Parteien an die AfD vermutlich nicht erreichbar. Zudem müssen die Parteien auch immer die Präferenzen ihrer bestehenden Wähler*innenschaft in ihre Strategien einbeziehen. Ein Heranrücken an die AfD könnte zur Folge haben, dass sie eigene Unterstützer*innen verlieren.
Weiter Informationen und Quelle
[1] Link zum Artikel: Fighting for a Lost Cause? Availability of Populist Radical Right Voters for Established Parties. The Case of Germany
Ansprechpartner:
PD Dr. Marcel Lewandowsky – Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre
marcel.lewandowskyuni-greifswaldde
Aerosol
Greifswald im Mondschein: Lassen sich die Gemälde von Caspar David Friedrich für die Klimaforschung nutzen?
Die Idee, aus den Farbverhältnissen historischer Gemälde Informationen über den Gehalt an Aerosolen in der Atmosphäre ableiten, klingt originell und vielversprechend. In einigen früheren Studien wurde versucht, die Menge an vulkanischen Aerosolen aus den Farben von Gemälden quantitativ zu bestimmen. Eine Studie [1], die Ende Oktober 2022 im Fachjournal Climate of the Past erschienen ist und als Research Highlight ausgewählt wurde, setzt sich kritisch mit diesem Ansatz auseinander. Das interdisziplinäre Forschungsteam aus den Universitäten Greifswald, Freiburg und Bremen kommt zu der Schlussfolgerung, dass eine quantitative Bestimmung des Aerosolgehalts aus Gemälden in den meisten Fällen unmöglich ist.
Es ist allgemein bekannt, dass Vulkanausbrüche zu ungewöhnlichen optischen Dämmerungserscheinungen führen können, wie beispielsweise dem rötlichen Nachleuchten oder einem ausgeprägten Purpurlicht. Diese Effekte sind gut verstanden und lassen sich mit geeigneten Modellen simulieren. Auch Gemälde können qualitative Zeugnisse von Vulkanausbrüchen enthalten. So werden Gemälde von J. M. W. Turner mit der Eruption des Tambora 1815 in Verbindung gebracht, oder die Aquarelle von William Ashcroft mit der Krakatoa Eruption 1883. In einigen früheren Studien wurde zudem versucht, aus den Rot-Grün-Farbverhältnissen historischer Gemälde (darunter einige Gemälde von Caspar David Friedrich), quantitative Informationen über den atmosphärischen Gehalt an vulkanischen Aerosolen abzuleiten. Dabei wurde angenommen, dass das Rot-Grün-Verhältnis mit steigendem Aerosolgehalt ansteigt. Da Vulkanausbrüche eine der wichtigsten Ursachen für natürliche Klimavariationen auf Zeitskalen von einigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt sind, könnten historische Gemälde demnach ein wichtiges Archiv für die Klimaforschung darstellen.
Die interdisziplinäre Studie setzt sich kritisch mit diesem Ansatz auseinander und zeigt, dass es zahlreiche weitere Parameter gibt, die einen großen Einfluss auf die Farbverhältnisse des Abendhimmels haben und die im Allgemeinen für historische Gemälde nur schlecht bekannt oder unbekannt sind. Mithilfe von Strahlungstransfersimulationen wurde die Abhängigkeit der Farben des Abendhimmels von allen relevanten Parametern, wie beispielsweise dem Sonnenstand, der Blickrichtung, der Menge an stratosphärischem Ozon sowie der Menge und den mikrophysikalischen Eigenschaften der vulkanischen Aerosole untersucht. Wie erwartet werden die Rot-Grün-Farbverhältnisse durch die Menge an Aerosolen beeinflusst. Allerdings werden die Farbverhältnisse auch von vielen anderen – für historische Eruptionen meist nur schlecht bekannte – Faktoren beeinflusst, so dass eine Bestimmung der Aerosolmengen in den meisten Fällen praktisch unmöglich ist. Dabei sind die Hauptprobleme die fehlende Kenntnis der Größe der Aerosolpartikel nach historischen Eruptionen, sowie der genauen Position der Sonne. Die Dämmerungsfarben verändern sich mit veränderlichem Sonnenstand schnell. Jedoch können Gemälde niemals Momentaufnahmen sein und werden teilweise zu viel späterer Zeit und im Atelier erstellt. Darüber hinaus dürfen realistisch anmutende Darstellungen in Gemälden nicht mit der Realität gleichgesetzt werden. Auch die Veränderung der Farben über teilweise einige Jahrhunderte hinweg lässt sich im Allgemeinen nicht einfach rekonstruieren. Insgesamt ist die quantitative Bestimmung der Aerosolmengen aus Gemälden aufgrund der vielen Unsicherheiten im Allgemeinen nicht möglich.
Quelle und weitere Informationen
[1] von Savigny, C., Lange, A., Hemkendreis, A., Hoffmann, C. G., and Rozanov, A.: Is it possible to estimate aerosol optical depth from historic colour paintings?, Clim. Past, 18, 2345–2356, https://doi.org/10.5194/cp-18-2345-2022, 2022.
Ansprechpartner an der Universität Greifswald
Prof. Dr. Christian von Savigny – Institut für Physik
csavignyphysik.uni-greifswaldde
Bernstein
Parasitische Plattwespe sticht Käferlarve … vor 100 Millionen Jahren
Wenn das Wort Fossil fällt, stellen sich die meisten Leute entweder Dinosaurier-Knochen oder Ammoniten-Schalen vor. Diese Tiere können vor allem durch ihre erstaunliche Größe beeindrucken. Allerdings gibt es auch andere Tiere, die fossilisieren können. Insekten, die ja heutzutage einen Großteil der Artenvielfalt ausmachen, sind auch im Fossilbefund häufig anzutreffen. Fossilisierte Insekten können auch spektakulär und vor allem fast lebensecht erhalten sein, vor allem in Bernstein (versteinertes Harz). In Bernstein können auch Interaktionen von Insekten erhalten sein, wenn zwei interagierende Insekten während dieser Interaktion von Harz eingeschlossen worden sind. In diesen Fällen kann man manchmal (mehr oder weniger genau) das vorzeitliches Verhalten dieser Tiere rekonstruieren.
Ein besonderer Fund: Plattwespe sticht Käferlarve in 100 Mio. Jahre altem Bernstein
Ein Forscherteam der Universitäten Greifswald und München sowie ein privater Bernstein-Sammler haben einen besonderen fossilen Fund entdeckt. Eingeschlossen in einem 100 Millionen Jahre alten Bernstein-Stück ist eine Plattwespe, die eine Käferlarve umklammert hält und mit ihrem Giftstachel in diese hineinsticht. Diese Art der direkten Interaktion ist sehr selten im Fossilbefund zu finden, da besondere Verhältnisse herrschen müssen, dass die Tiere so zusammen in einer Interaktion sozusagen „eingefroren“ erhalten bleiben. Dies ist zudem einer der ältesten Funde einer direkten Interaktion zwischen einer parasitischen Wespe und ihrem Wirt im Fossilbericht. Dies deutet darauf hin, dass eine parasitische Lebensweise innerhalb der Wespen schon seit mindestens 100 Millionen Jahren ähnlich wie heute existiert.
Was ist Parasitismus?
Viele Menschen nehmen Wespen in erster Linie als Plagegeister wahr, die schmerzhaft stechen können und lästig sind. Allerdings leben die meisten Wespenarten fernab von Menschen und sind zudem parasitisch. Parasitismus ist eine schädliche Form der Symbiose, es besteht also eine Abhängigkeit zwischen dem Parasiten und seinem Wirt. Viele Parasiten können ohne ihren Wirt nicht überleben, da der Wirt ihre Nahrungsgrundlage darstellt.
Die meisten Wespen sind parasitisch
Plattwespen leben heutzutage als Larve parasitisch auf Käferlarven und Raupen, also Schmetterlingslarven, und ernähren sich von deren Körperflüssigkeiten. Das Muttertier dieser parasitischen Wespenlarven sucht nach einer geeigneten Insektenlarve als Wirt und sticht diese dann mit ihrem Giftstachel, sodass die Larve zunächst betäubt wird, und legt anschließend ihre Eier auf der Larve ab. Es ist wichtig, dass die betäubte Larve noch lebt, damit die Wespenlarven sich gut und vor allem lange von dieser ernähren können. An die Wirtsinsektenlarve geheftet entwickeln sich die Wespenlarven weiter und verpuppen sich am Ende der Larvenphase. Aus den Puppen entwickeln sich die erwachsenen Wespen, die dann die meist komplett verzehrte Insektenlarve endgültig töten. Das Stück Bernstein, in dem die Plattwespe mit ihrem Giftstachel in die Käferlarve hineinsticht und diese umklammert hält, zeigt, dass das Wirt-betäubende Verhalten der heutigen Plattwespen vor der Eiablage schon in der Kreidezeit existiert hat. Zudem ist es ein Hinweis auf eine parasitische Lebensweise dieser fossilen Plattwespenart.
Die Evolutionsgeschichte der Hautflügler (Wespen, Bienen, Ameisen)
Insekten gibt es schon seit vermutlich mindestens 400 Millionen Jahren. Hautflügler, die die Gruppe der Stechimmen wie Wespen sowie Bienen, Hornissen und Ameisen einschließen, existieren seit ungefähr 250 Millionen Jahren. Die ältesten bekannten fossilen Vertreter der Plattwespen sind ca. 130 Millionen Jahre alt, welche ebenfalls in Bernstein gefunden wurden. Plattwespen sind näher mit den (eu-)sozialen, also vor allem staatenbildenden Hautflüglern wie Bienen, Hummeln und Ameisen verwandt, als die früheren, ausschließlich parasitischen Vertreter der Hautflügler. Eine parasitische Lebensweise ist sehr häufig bei heutigen Hautflüglern und wird als einer der Gründe betrachtet, weshalb Hautflügler heute so artenreich sind. Über die Evolution dieser Lebensweise innerhalb der Gruppe der Hautflügler ist bisher noch vieles unbekannt. Allerdings stellt das gefundene Bernstein-Stück den ältesten Nachweis einer Interaktion zwischen Plattwespe und Käferlarve dar und legt nahe, dass eine parasitische Lebensweise in den Hautflüglern schon früh in deren Evolution vorhanden war.
Mit welchen Methoden kann man ein Stück Bernstein untersuchen?
Das ca. 100 Millionen Jahre alte Stück Bernstein, das im Zentrum dieser Studie steht, wurde von Patrick Müller, einem privaten Bernstein-Sammler, gefunden. Der Bernstein kommt aus Myanmar in Südostasien, wo er vor ca. 100 Millionen Jahren ein Harztropfen war, der über die Zeit zu Bernstein versteinerte. Das Stück Bernstein wurde mithilfe von Makrophotographie und eines Mikro-Computertomographen von Christine Kiesmüller, Marie K. Hörnig (beide Universität Greifswald) und Joachim T. Haug (LMU München) dokumentiert.
Quelle und weitere Informationen
Kiesmüller C, Haug JT, Müller P, Hörnig MK (2022). A case of frozen behaviour: A flat wasp female with a beetle larva in its grasp in 100-million-year-old amber. Fossil Record 25(2): 287–305. https://doi.org/10.3897/fr.25.82469
AG Cytologie und Evolutionsbiologie (Universität Greifswald)
AG Haug – Zoomorphologie (Universität München)
Palaeo-Evo-Devo: Evolutionary Developmental Palaeobiology
Ansprechpartnerin
Christine Kiesmüller
christine.kiesmuellerstud.uni-greifswaldde
Parodontitis
Menschen mit der Zahnbettentzündung haben ein höheres Risiko für die Entwicklung des Alzheimer-Syndroms
In den vergangenen Jahren ist der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Allgemeinerkrankungen immer mehr in den Mittelpunkt der oralen Forschung gerückt. Parodontitis wird unter anderem mit kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes, Rheuma und Alzheimererkrankungen assoziiert. Beobachtungsstudien wie SHIP (Study of Health in Pomerania) zeigten, dass Parodontitis ein unabhängiger Risikofaktor für die genannten chronischen Erkrankungen ist. Über die genauen Mechanismen wird noch diskutiert: Zum einen gelangen bei parodontalerkrankten Menschen beim Kauen oder Zähneputzen Parodontalkeime in die Blutbahn, wodurch in verschiedenen Endorganen chronische Erkrankungen begünstigt werden. Ein anderer Pfad könnte über die lokale Entzündung im Mund gehen, wobei oral gebildete Entzündungsmediatoren aus dem parodontalen Entzündungsgewebe in die Blutbahn eingeschwemmt werden und dadurch die chronische, systemische Entzündung verstärken. Diese spielt bei vielen chronischen Erkrankungen eine wichtige Rolle in der Ätiologie (Lehre von den Krankheitsursachen).
Immer wieder untersucht wurde die Frage, ob eine Parodontaltherapie den Krankheitsverlauf einer chronischen Erkrankung, wie z.B. Diabetes Typ 2, beeinflussen kann, denn es ist bekannt, dass eine Parodontaltherapie zu einer Verminderung der subklinischen chronischen Entzündung führt. Metaanalysen konnten nachweisen, dass eine Parodontaltherapie den Blutzucker von Typ 2-Diabetikern in der Größenordnung wie ein zweites Antidiabetesmedikament reduziert. In Greifswald konnten wir in einer multizentrischen Studie [1] zeigen, dass auch bei den meisten Prädiabetikern der Blutzuckerspiegel sich durch eine Parodontalbehandlung normalisiert.
Die Frage, ob eine Parodontitis mit einer Alzheimererkrankung zusammenhängt, wurde derzeit auch untersucht. Orale Bakterien aus den Zahntaschen können möglicherweise auch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, denn bei Untersuchungen von Gehirnen verstorbener Alzheimer-Patienten konnten Wissenschaftler oft den Keim Porphyromonas gingivalis identifizieren [2], der als Markerkeim für eine Verschiebung der bakteriellen Flora von gesund zu erkrankt in der Zahnfleischtasche angesehen wird. All diese Ergebnisse verstärken die Hypothese, dass Parodontitis in einem direkten Zusammenhang mit einer Alzheimererkrankung stehen könnte. In einer Studie aus Greifswald [3] konnten wir zeigen, dass eine Parodontalbehandlung zu einer Verzögerung der Hirnalterung führt. Weitere Studien müssen zeigen, ob dadurch auch die Progression zu einer Alzheimererkrankung vermindert wird.
Parodontitis: Ursachen
Parodontitis wird verursacht durch bakterielle Beläge, die an den Zähnen fest anhaften. Werden diese Beläge nicht regelmäßig entfernt, so rufen sie eine Entzündungsreaktion im Zahnhalteapparat hervor, der den Zahn umgibt und ihn im Kieferknochen verankert. Es sind nicht direkt die Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte, sondern die durch sie hervorgerufenen Entzündungsreaktionen, die zum Abbau des parodontalen Stützgewebes führen. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, wird durch die chronische Zahnfleischentzündung zunehmend Zahnhalteapparat abgebaut, es bilden sich Zahnfleischtaschen, das Zahnfleisch geht zurück, und letztendlich können die Zähne sich lockern und müssen extrahiert werden. Im Erwachsenenalter ist Parodontitis neben Karies die Hauptursache für Zahnverlust. In der Regel verursacht Parodontitis keine Schmerzen und wird deshalb oft nicht diagnostiziert. Je früher eine Parodontitis erkannt und behandelt wird, desto besser kann ihrer Progression entgegengewirkt werden. An folgenden Symptomen können Patient*innen eine Parodontitis bemerken: Zahnfleischbluten und Mundgeruch.
Die eigentliche Ursache einer parodontaler Entzündung ist eine Verschiebung der Keimzusammensetzung in der Plaque. Der Anteil proinflammatorisch wirksamer Keime wie Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans nimmt zu und wenn ihr relativer Anteil innerhalb der Biofilme ein kritisches Maß übersteigt, kommt es zum Auftreten klinischer Entzündungssymptome.
Risikofaktoren für eine Parodontalerkrankung sind soziale Deprivation, Rauchen, Übergewicht und schlecht eingestellter Diabetes, wobei ca. 30 bis 40 % der Varianz durch eine genetische Disposition erklärt werden. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, welche Gene eine Parodontitis mitverursachen.
Die Standardtherapie einer Parodontitis basiert auf der Entfernung subgingivaler bakterieller Zahnbeläge und einer Verbesserung der häuslichen Zahnpflege. Die zahnärztliche Behandlung besteht in der Regel neben der Aufklärung des Patienten in einer gründlichen Reinigung der Zahnfleischtaschen, wodurch die Bakterienmenge reduziert und damit der ständigen Entzündungsreiz beseitig wird.
Entscheidend für den langfristigen Behandlungserfolg ist die aktive Mitarbeit des Patienten: Zum einen sollten Patienten eine optimale Mundhygiene zu Hause durchführen, zum anderen sind lebenslang regelmäßige Kontroll- und Behandlungstermine beim Zahnarzt bzw. seinem Team notwendig. In diesen Sitzungen wird die Mundhygiene überprüft und gegebenenfalls korrigiert und die supra- und falls noch vorhanden die subgingivalen bakteriellen Beläge entfernt. Nur so kann einer weiteren Progression einer Parodontitis entgegengewirkt werden. Die Zähne sollten zweimal täglich mit einer Zahnbürste und die Zahnzwischenräume einmal am Tag gereinigt werden. Da die Zahnzwischenräume unterschiedlich groß sind, muss das zahnärztliche Team dem Patienten den Gebrauch entsprechender Hilfsmittel zeigen. In der Study of Health in Pomerania (SHIP) konnten wir zeigen, dass eine elektrische Zahnbürste effektiver als eine Handzahnbürste die supragingivalen Beläge entfernt und langfristig zum einem besseren Zahnerhalt führt.
Ansprechpartner
Prof. Dr. med. dent. Thomas Kocher
kocheruni-greifswaldde
Quellen und Weitere Informationen
[1] Effect of Periodontal Treatment on HbA1c among Patients with Prediabetes
[2] Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors.
[3] Effect of periodontal treatment on preclinical Alzheimer's disease-Results of a trial emulation approach Parodontitis und Diabetes aus zahnärztlicher Sicht
Porträtieren in der Universität Greifswald
Porträtieren in der Universität Greifswald: Stand? Charakter? Lebenswerk?


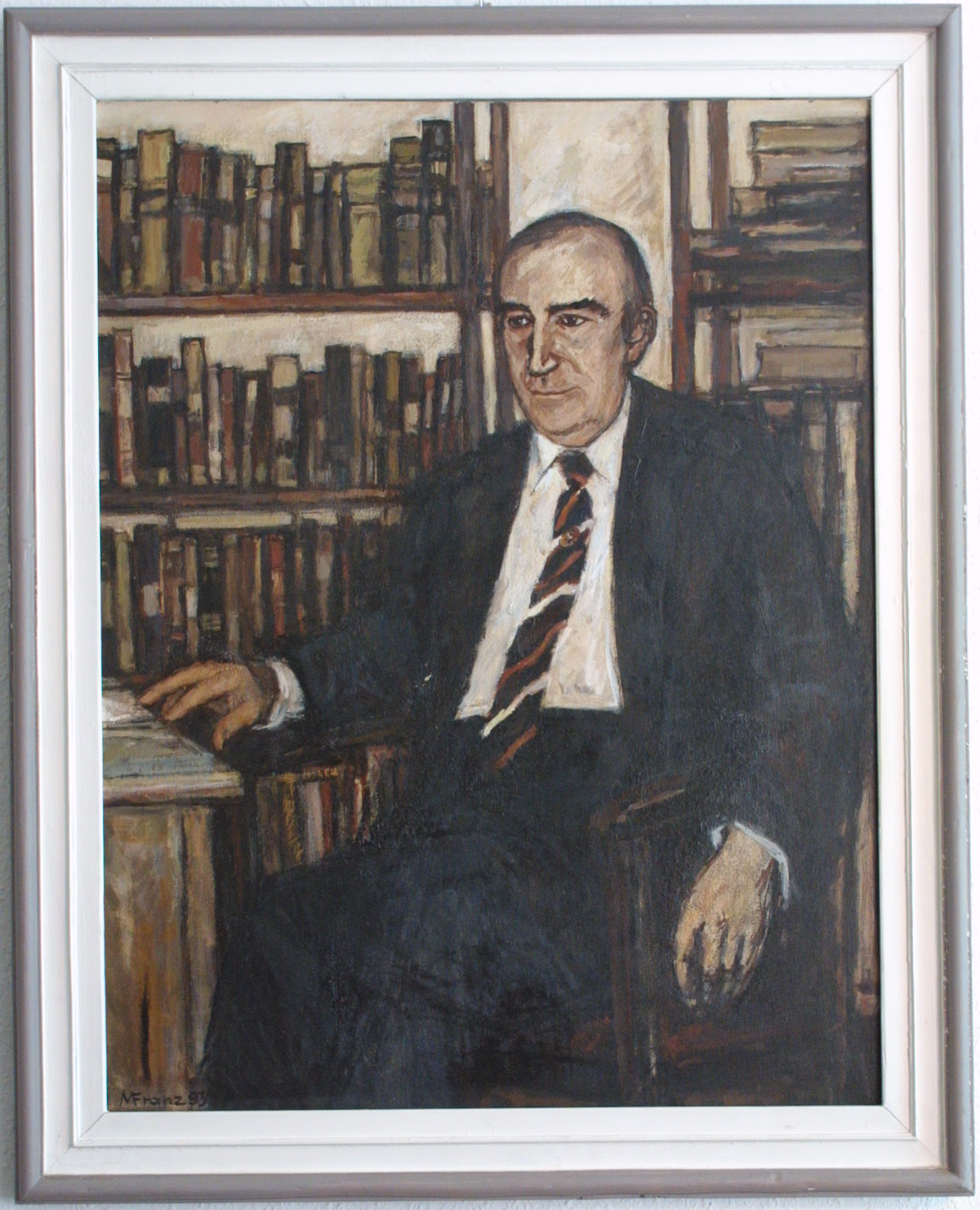
Im Juli 2022 erhielt die Universität Greifswald das Porträt der ersten Rektorin in der Universitätsgeschichte seit 1456. Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber, Rektorin von 2013 bis 2021, wurde von der Malerin Katrin Lau in Lubmin porträtiert. Professor*innen und Rektorenporträts haben eine lange akademische Tradition.
Ab Ende des 17. Jahrhunderts wurden auch in Greifswald immer wieder posthum Porträtgemälde von Rektoren und Professoren, nach Kupferstichen und später Fotografien, als Geschenke der Porträtierten oder durch die Hochschule selbst beauftragt und bezahlt. Das Auffinden von Greifswalder Gelehrtenbildnissen in Privatbesitz und aus Nachlässen sowie Geschenke ermöglichen heute eine allmähliche Komplettierung der „Ahnen“-Galerie. Kurz nach dem politischen Umbruch 1989/90 sowie der Neuorientierung gab es einen spektakulären Diebstahl von 45 Porträtgemälden aus dem Konzilsaal im Hauptgebäude der Universität. Nach der Rückkehr der Gemälde rieten Fachleute der Universität, die seit 1850 nur sporadisch gepflegte Tradition der Rektorenporträtierung wieder aufzunehmen. Seit 1991 werden wieder alle Rektor*innen von Künstler*innen porträtiert.
Das erste Nachwendeporträt des Rektors Hans-Jürgen Zobel (1928–2000) malte Martin Franz (1928–2016), Professor am Caspar David Friedrich-Institut. Franz hatte bereits 1965 ein ausdrucksstarkes Bildnis eines Wissenschaftlers geschaffen: des Philosophen Günther Jacoby (1881–1969) auf seinem wuchtigen Lehnstuhl, die Betrachtenden fixierend. Es ist ein Gelehrtenbildnis inmitten der Studierstube. Man sieht dort sich türmende Bücher auf dem Klappsekretär, Porzellanfiguren und als Bild im Bild ein Porträt oben links. Weder die Fakultät noch die Universität interessierten sich damals für das Gemälde, denn nach Ächtung im Nationalsozialismus war Jacoby auch in der Zeit des Umbaus der akademischen Philosophie zum Marxismus-Leninismus-Institut in Ungnade gefallen. Das Bild blieb 50 Jahre im Besitz des Künstlers und gelangte erst 2021 in die Greifswalder Professorengalerie.
Die Tradition des Porträts
Im Gegensatz zu diesem Bild verfolgten die Anfänge unserer Bildnissammlung keine besonders ausgeklügelte Charakterkunde der Dargestellten und wollen auch kaum Hinweise auf die Tätigkeitsfelder der Gelehrten geben. Bestenfalls halten die Herren als Zeichen ihrer Zunft ein Buch in der Hand, Gelehrte der Medizinerfakultät mehrfach einen Maiglöckchen-Blütenstand.Vorrangiger war es, durch eine üppige Lockenperücke auf den gesellschaftlichen Stand hinzuweisen. Die Beschriftung über den Köpfen nannte akademische Grade, kirchliche und weltliche Ämter in der Verwaltungshierarchie, deren Teil die Professoren der pommerschen Landesuniversität im Regelfall waren. Es erschien wichtig, auf familiäre Herkunft, gegebenenfalls gar auf das Adelsprädikat der Familie zu verweisen.
Diese Professorenbilder des 18. Jahrhunderts, die ebenso Ratsherren- oder Bürgermeisterbilder in den Rathäusern der Hansestädte sein könnten, waren schon damals eher altbacken bei der künstlerischen Darstellung von geistig arbeitenden Menschen. Lange hatte sich bereits in Italien, den Niederlanden und auch in den großen deutschen Städten ein Typus des erzählenden Gelehrtenbildnisses entwickelt. Bekannt sind Anatomiebilder wie das berühmte Gemälde Rembrandts „Anatomie des Dr. Tulp“ von 1632, die wie Momentaufnahmen bei der Leichensektion wirken. Oder Naturkundler wie der Leipziger Gelehrte Johann Heinrich Linck oder Frederik Ruysch sitzen üppig gekleidet und mit Allongeperücke inmitten ihrer Bücherregale, Sammlungsschubladen und Präparategläser, gern auch mit der Schreibfeder in der Hand. Derartige Bilder konnten Sammlungs- und Forschungskonzepte der Dargestellten minutiös visualisieren.
Auch das 19. Jahrhundert schloss sich einer derartigen Porträtkunst an. Beispielsweise in Berlin griffen Künstler die barocke Bildkomposition des Gelehrten in seinem Arbeitszimmer-Mikrokosmos wieder auf. Großformatige, aufwendige Kniestücke oder Ganzkörperbildnisse malte beispielsweise Ludwig Knaus für die Preußische Gelehrtengalerie der Träger des Ordens Pour le Mérite: Hermann von Helmholtz scheint uns da am Tisch mit schwerer Tischdecke sitzend und unter dem Erdglobus sein Lebenswerk anhand von Dingen zu erläutern: Stimmgabel und Kugelresonator stehen für die Forschung zur Akustik und Hörempfindung, und die übrigen Instrumente betreffen unter anderem die augenärztliche Diagnostik. Betrachter stellen die Frage: Was schimmert da so messingfarben, was ist das? Helmholtz scheint antworten und erklären zu wollen.
Kein einziges derartiges Bild mit Bezug zum Werk des Porträtierten entstand damals in Greifswald. Erst im Jahr 1901 erwarb die Universität ein Gelehrtenbildnis, das explizit das wissenschaftliche Opus Magnum des geehrten Altrektors thematisiert. Der Orientalist Wilhelm Ahlwardt (1828–1909) wurde von dem Berliner Bildhauer Wilhelm Wandschneider als Marmorbüste porträtiert: Die Plinthe der Büste ist ein Folioband, nämlich Band X für das Register seiner Darstellung der arabischen Handschriften in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, der heutigen Staatsbibliothek. Noch heute verweist die Stabi auf die digitalisierte Version dieser gewaltigen Arbeit als Findbuch für die unermesslich wertvollen Schriften.
Das jüngste Bild der Porträtsammlung ist das Bildnis der ersten Frau im Greifswalder Rektoramt. Rektorin Johanna Eleonore Weber schaut uns frontal durch ihre Brillengläser an. Hinter ihr ist kein Versinken im Nichts dunkler Farbe, sondern die Wand einer Stube ist erkennbar. Zwei Bilder hängen dort. Gut erkennbar „Der Planet“ des in der DDR sorgsam beäugten Surrealisten Manfred Kastner (1943–1988).
Die Künstlerin Katrin Lau hatte in der Vorzeichnung angelegt, Johanna Weber vor Kunstwerken an der Wand zu porträtieren. Die Wahl fiel auf das Kastner-Bild, weil dieses Ölgemälde aus dem Bestand unserer universitären Kunstsammlung jahrelang im Rektorinnenbüro ein täglicher Anblick der Porträtierten war. Das sagt etwas über Kunstgeschmack und Vorlieben aus.
Damit haben wir eine ikonografisch in mehrfacher Hinsicht neue Variante des Rektor*innen-Bildnisses vorliegen. Es ist eine Würdigung der Porträtierten, kommt aber andererseits auch der Verpflichtung einer Universität nach, ihre eigene Geschichte anhand von qualitätsvollen Originalen dauerhaft zu dokumentieren.
Ansprechpartner
Dr. Thilo Habel
Leiter der Kustodie
Telefon +49 3834 420 3061
thilo.habeluni-greifswaldde
kustodie@uni-greifswald.de
Sandaufspülungen
Sandaufspülungen als Schutz vor dem Meeresspiegelanstieg? Ahrenshoop nimmt an Befragung zu naturbasiertem Küstenschutz teil
Der Außenküstenbereich an der Ostsee in Ahrenshoop (Mecklenburg-Vorpommern) wird durch den Meeresspiegelanstieg bedroht. Bei jedem Sturmhochwasser werden große Mengen Sand fortgespült. Der Verlust des Strandes hätte gravierende Konsequenzen für Ahrenshoop aber auch für die gesamte Region Fischland-Darß-Zingst sowie deren Binnenküste, da der Küstenabschnitt in Ahrenshoop eine übergeordnete Rolle im regionalen Hochwasserschutz spielt.
Um den Küstenschutz weiterhin zu gewährleisten, werden strategische traditionelle Schutz-Infrastrukturen wie Deiche, Buhnen und Wellenbrecher mit „sanften“ Küstenschutzmaßnahmen, z.B. Sandaufspülungen, die Bepflanzung und Pflege der Dünen ergänzt. Außerdem wird die Erosion der aktiven Steilküste südlich von Ahrenshoop zugelassen, da diese eine wichtige Rolle als Sedimentquelle für den Schutz des Strandes sowie den Naturschutz spielt, obwohl der Rückgang der Steilküste den aktuellen Sedimentdefizit nicht ausgleicht.
Sandaufspülungen gehören zu sogenannten naturbasierten Maßnahmen, die durch die Wiederherstellung von natürlichen Prozessen und Renaturierung von ökologischen Puffern zum Schutz u.a. vor Hochwasser beitragen. Um effektiv zu sein, müssen sie in regelmäßigen Abständen stattfinden.
Die jüngsten Sandaufspülungen in Ahrenshoop fanden im Winter 2021/2022 statt. Diese Maßnahme wurden durch das Forschungsprojekt ECAS-Baltic wissenschaftlich begleitet, um die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen zu untersuchen. Eine wichtige Komponente dieser Untersuchungen ist eine Umfrage unter der Ahrenshooper Bevölkerung, die durch das Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald im Herbst/Winter durchgeführt wurde. Ziel war es, ein lokales Meinungsbild über die aktuellen Küstenschutzmaßnahmen zu erstellen. Dazu wurden teilstandardisierte Fragebögen eingesetzt und Einzelgespräche durchgeführt. Insgesamt nahmen 158 Personen teil, insbesondere beteiligten sich Männer, ältere Personen und Personen mit hohen Schul- und Berufsabschlüssen.
Küstenschutz als Balance-Akt zwischen Natur und Gesellschaft
Eine erste Auswertung der Befragungen zeigt, dass Natur und Landschaft als wichtigster Faktor für die Verbundenheit mit der Region empfunden werden. Gleichzeitig werden naturbezogene Prozesse als Gefahren wahrgenommen. Besonders der Küstenabbruch, Stürme und Sturmfluten werden genannt. Diese Gefahren werden überwiegend als stark zunehmend eingeschätzt. Der Klimawandel wird von der Mehrheit als zukünftiges Risiko betrachtet, vor allem für den Zustand des Strandes und der Dünen sowie die Häufigkeit und den Schweregrad von Hochwasser.
Die meisten Befragten gaben an, die Schutzwirkung der Dünen zu respektieren und sie deshalb nicht betreten zu wollen. Darüber hinaus ist dem Großteil das natürliche Aussehen der Dünen wichtig. Die Sandaufspülung wird dabei mehrheitlich als geeignete Maßnahme zur Anpassung an den Meeresspiegelanstieg angesehen. Einige Befragte haben dennoch Bedenken bezüglich deren Effektivität und den ökologischen Auswirkungen der Entnahme des Sandes für die Aufspülungen aus der Ostsee. Unzufriedenheit wurde hauptsächlich beim fehlenden Schutz der Steilküste formuliert. Im Allgemeinen fühlten sich die Befragten mehrheitlich gut geschützt, dennoch wurden Wünsche nach mehr Transparenz und Mitbestimmung geäußert. Allerdings war die Mehrheit der Befragten nicht bereit, sich direkt finanziell am Küstenschutz beteiligen zu wollen.
Diese und weitere Ergebnisse des Projekts wurden am 15. Juni 2022 den Bürger*innen in Ahrenshoop vorgestellt. Es folgte eine rege Diskussion über:
- natürliche und durch den Menschen beeinflusste Änderungen an der Küste, die zu einer Erhöhung der Verwundbarkeit führen können,
- unterschiedliche Küstenschutzansätze sowie die Bewertung derer Auswirkungen und Effektivität aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Rahmen,
- den Küstenschutz als Kompromiss zwischen ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen Prioritäten und Machbarkeit
- Möglichkeiten für einen naturbasierten Küstenschutz und Hindernisse,
- die Rolle der Wissenschaft in der Förderung einer demokratischen Debatte über notwendige Küstenanpassung im Zeitalter des Klimawandels.
Das Programm, erste Ergebnisse und eine Zusammenfassung der Diskussion sind (bzw. werden demnächst) auf der Webseite der Veranstaltung zu finden sein: Link ️
Demnächst werden wir die Auswertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Sandaufspülungen abschließen. Wichtige Botschaften werden zusammengefasst und sowohl an die Gemeinde als auch an Entscheidungsträger weitergeleitet.
Das Forschungsprojekt ECAS-Baltic wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA)“ gefördert. ECAS-Baltic wird unter der Leitung von PD habil. Dr. Jochen Hinkel (Global Climate Forum, Berlin), weiterhin sind Wissenschaftler*innen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU-), Ludwig-Franzius-Institute for Hydraulic, Estuarine and Coastal Engineering, Leibniz Universität Hannover (LUH), Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), Leibniz-Institute for Baltic Sea Research (IOW), Warnemünde, Universität Rostock und Universität Greifswald beteiligt.
Ansprechpartner an der Universität Greifswald
Dr. A. Cristina de la Vega-Leinert
Institut für Geographie und Geologie
Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16, 17489 Greifswald
ac.delavegauni-greifswaldde
Radikalisierung
Nicht nur radikal, sondern extrem – eine Begriffsbestimmung
Die Begriffe Radikalisierung und Extremismus sind in Medien und im Alltag aktuell allgegenwärtig – sei es in Berichten über die Hintergründe von Anschläge und Gewalttaten oder in Diskussionen über politische Parteien oder die Bewertung von Maßnahmen der Infektionsprävention. Dabei ist nicht immer klar, was als radikal oder extrem gilt, wann Radikalisierung beginnt und wie diese Konzepte voneinander abgegrenzt werden können. Welches Ausmaß an Radikalisierung ist erwartbar oder gar normativ und ab wann gilt es als bedrohlich?
In der Forschung wird Extremismus zumeist als eine bedeutsame Abweichung oder Abwendung von bestehenden politischen und gesellschaftlichen Werten und (Rechts-) Normen definiert, die auf deren Abschaffung oder Ersetzung ausgerichtet ist. Diese Abweichung kann sich in Einstellungen oder Verhalten äußern, etwa dem Einsatz von Gewalt zur Erreichung der eigenen Ziele, und stellt damit einen Endpunkt eines Prozesses dar. Dieser Prozess, der zur Entstehung der Abweichung führt, kann als Radikalisierung bezeichnet werden. Diese Definition erlaubt eine deutliche Unterscheidung der beiden Konzepte, wirft aber auch eine Reihe von Fragen auf, z.B. welche Werte und Normen zugrunde gelegt werden (z.B. Grundgesetz), ab wann von einer bedeutsamen Abweichung gesprochen werden kann und wie der Radikalisierungsprozess genau gestaltet ist.
Wie entsteht Radikalisierung?
Modelle der Radikalisierungsforschung reichen von Stufenmodellen, die einen festen Ablauf an Schritten zunehmender Radikalisierung beschreiben bis hin zu Phasen- oder Prozessmodellen, die stärker die Dynamik von Radikalisierung in den Blick nehmen. Gemein ist diesen Ansätzen eine Entwicklungsperspektive, die eine graduelle Beschreibung von Radikalisierung im Lebenslauf erlaubt, da ein Großteil der Forschung auf der rekonstruktiven Analyse von Biografien basiert und damit Entwicklungsverläufe von Radikalisierung nachzuzeichnen imstande ist.
Demnach liegen die Wurzeln von Radikalisierung bereits im frühen Kindes- und Jugendalter, da gesellschaftliche, soziale und biologische Kontexte (z. B. genetische Prägung der Intelligenz, Wertevorstellungen des sozialen Umfelds, zeitgeschichtliche, einschneidende Ereignisse) und individuelle Entwicklungsschritte (z. B. Erarbeitung des Selbstwerts, Erlangen von Autonomie) gemeinsam zur Entstehung von (radikalen) Einstellungen beitragen können. Wenn Kinder und Jugendliche beispielsweise in einem Umfeld aufwachsen, in dem normwidriges Verhalten wiederholt belohnt wird, kann dies eine Lernerfahrung sein, die eine spätere ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Werten und Normen begünstigt. Im weiteren Verlauf, insbesondere im Jugend- und jungen Erwachsenenalter (zw. 14-30 Jahren), kommen dann weitere Prozesse hinzu, die für Radikalisierungsverläufe wichtig sein können, nämlich die Entwicklung einer eigenen Identität, einer weltanschaulichen Überzeugung und die Auswahl und Festigung relevanter sozialer Gruppen (z. B. Freundeskreise in Ausbildung oder Studium sowie Interessensgemeinschaften im digitalen Raum). Diese Gruppen können eigene Einstellungen verstärken (wenn sie gleiche Ansichten haben), oder korrigieren (wenn die Ansichten gegenläufig sind) – wenn es sich dabei um Einstellungen fern gesellschaftlich akzeptierter Normen und Werte handelt, können entsprechend Radikalisierungstendenzen verstärkt werden. Radikale Gruppen, die z. B. zur Gewalt aufrufen, vermitteln ihre ideologischen Positionen häufig über Narrative; dies sind Erzählungen, die Werte, Einstellungen oder Verhalten als richtig oder falsch bewerten und dafür einen entsprechenden Erklärungsrahmen liefern. Damit bieten sie eine klare Orientierung für die eigene Einstellungsbildung. Solche Gruppenprozesse können sich auch im mittleren und höheren Erwachsenenalter fortsetzen, da zunehmend bewusst und gezielt Kontexte und Gruppen gewählt und aufgesucht werden können, die die eigene Haltung bestärken. In Bezug auf digitale Medien, z. B. soziale Netzwerke, werden in diesem Zusammenhang auch die Begriffe Echokammer und Filterblase gebraucht, um die soziotechnischen Prozesse zu beschreiben, die dazu führen, dass vor allem Weltanschauung- und interessenkonforme Inhalte präsentiert werden (Filterblase) und solche Gruppen und Einstellungen sichtbar werden, die der eigenen Haltung nahestehen und sich dadurch gegenseitig verstärken (Echokammer). Damit sind Grundlagen und Prozesse von Radikalisierung beschrieben, aber zu klären ist die Frage, wann Radikalisierung zu Extremismus führt.
Wann entsteht Radikalisierung?
Im Kern ist eine wahrgenommene Ungleichheit Beginn eines Radikalisierungsprozesses: Ungleichheit kann durch äußere Einflüsse einstehen, wie Krieg, Finanzkrise oder Pandemie, die z. B. bestehende Disparitäten verstärkt oder neue entstehen lässt, etwa durch unterschiedliche Ressourcen im Umgang mit diesen Herausforderungen. Ungleichheit kann aber auch durch eine wahrgenommene Ungerechtigkeit oder auch einen persönlichen Verlust entstehen, der eine eigene Statusveränderung vor Augen führt. Eine Veränderung des Lebensstandards infolge des Arbeitsplatzverlusts wäre ein solches Beispiel. Wenn diese Ungleichheit als ungerecht erlebt und mit weiteren Werturteilen verbunden wird, z. B. als Ablehnung der als auslösend identifizierten Bedingungen oder Gruppen (z. B. der Regierung), kann dadurch Handlungswille entstehen, um Ungerechtigkeit zu beseitigen. Wenn dann etwa Gewalt als legitimes Handlungsmittel erkoren wird, um die Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist der Schritt zum Extremismus vollzogen. Im KATAPULT-Magazin wurde Anfang des Jahres in diesem Kontext auf die Verbreitung rechtspolitischer Einstellungen in Deutschland (anhand rechter Narrative) als Nährboden für den Rechtsextremismus verwiesen.
Besondere Beachtung verdient dabei die Komplexität der Weltanschauung – steht die Zustimmung zur ersten Aussage in Zusammenhang mit einer negativen Bewertung der dort beschriebenen Gruppe? Wird die Gruppe der „Ausländer“ als Bedrohung erlebt (z. B. als gefährlich)? Und wird zugleich Maßnahmen zugestimmt, um diese Bedrohung zu reduzieren (z. B. die Forderung, „Ausländer wieder in ihre Heimat zurück [zu] schicken“? Diese Zuspitzung der Einstellung kann auch als zunehmende Radikalisierung verstanden werden, da sie von bloßen Annahmen über die Intentionen anderer Personen bis hin zur Unterstützung konkreter Maßnahmen reichen.
In einer aktuellen Studie (Schroeder et al., 2022) haben wir ebenfalls solche Zustimmungswerte unter 6715 deutschen Jugendlichen untersucht und festgestellt, dass rund 6 Prozent (307 Jugendliche) entsprechend radikale Einstellungen aufwiesen, dabei allerdings nur ein geringer Anteil mit komplexen rechtspolitischen Einstellungen. Der größte Teil berichtete keine Zustimmung zu rechten Narrativen; einige stimmten nur bestimmten Aussagen zu, etwa der Forderung nach Nationalstolz oder Patriotismus, ohne dabei jedoch explizite chauvinistische Bezüge herzustellen. Als bedeutende Risikofaktoren für ein stark radikales Einstellungsprofil konnten wir männliches Geschlecht, wahrgenommene Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie frühere Gewalttaten identifizieren und damit Ergebnisse früherer Forschung bestätigen.
Wie kann Radikalisierung in den Extremismus verhindert werden?
Diese Befunde machen deutlich, dass Radikalisierung früh beginnt, komplexen Prozessen folgt und eine breite Grundlage in der Bevölkerung besitzt. Gleichwohl liefern sie auch eine wichtige Basis für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Prävention, die zu Beginn (z. B. in der frühkindlichen Entwicklung) und im Verlauf (z. B. in Schule oder Studium) von Radikalisierungsprozessen ansetzen können, um die Entstehung extremistischer Einstellungen und das Ausführen extremistischer Handlungen zu verhindern. Dazu zählen beispielsweise Ansätze der politischen Bildung und Medienbildung, der gewaltfreien Kommunikation und der positiven Jugendentwicklung. An dieser Stelle sind Politik, Praxis und Gesellschaft aufgefordert, Hand in Hand zu arbeiten – konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis aktueller Forschung (Beelmann et al., 2020) können hier eingesehen werden.
Originalveröffentlichungen
Beelmann, A., & Lehmann, L. (2020).* Radikalisierung im digitalen Zeitalter. Handlungsempfehlungen an Politik, Praxis und Gesellschaft. Kurzfassung. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
Schroeder, C. P., Bruns, J., Lehmann, L., Goede, L.-R., Bliesener, T., & Tomczyk, S. (2022). Radicalisation in Adolescence – The Identification of Vulnerable Groups. European Journal on Criminal Policy and Research, 28, 177-201. doi.org/10.1007/s10610-022-09505-x
Ansprechpartner
Jun.-Prof. Dr. Samuel Tomczyk
Robert-Blum-Str. 13
17487 Greifswald
Tel.: +49 3834 420 3806
samuel.tomczykuni-greifswaldde
Affenpocken
Affenpocken – Eine Pandemiegefahr?
Steht uns mit den Affenpocken die nächste Pandemie bevor?
Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen, aber eine neue Pandemie kann noch verhindert werden. Eine weltweite und langanhaltende Ausbreitung wie beim Sars-CoV2-Virus ist nicht zu erwarten. Das liegt zum einen daran, dass die Affenpocken durch engen Körperkontakt übertragen werden, also vor allem durch sexuelle Kontakte oder direkten Kontakt zu Bläscheninhalt und Schorf Infizierter [1]. Damit ist die Übertragung deutlich schwieriger als bei Sars-CoV-2, das beim Atmen, Husten oder Sprechen auch über größere Distanzen sehr leicht übertragen wird. Des Weiteren sind die Symptome einer Affenpocken-Infektion sehr charakteristisch. Zwar können typische Hautveränderungen wie bläschenartige Ausschläge im Gesicht oder im Genitalbereich auch mild sein und nur vereinzelt auftreten, sie sind aber dennoch zu erkennen. Kontakte können dadurch gut nachverfolgt und Infektionsketten schnell unterbrochen werden. Schließlich ist eine Affenpocken-Pandemie auch deshalb unwahrscheinlich, weil es bereits Medikamente und wirksame Impfstoffe gegen das Virus gibt.
Warum breitet sich der Erreger plötzlich weltweit aus?
Bisher ist das Virus vor allem aus Zentral- und Westafrika bekannt, das Reservoir sind Nagetiere, zum Beispiel Hörnchen [2]. Wir Menschen sind – genau wie Affen – sogenannte Fehlwirte, die nur in seltenen Ausnahmefällen infiziert werden. Auch dass das Virus, wie bei den aktuellen Fällen, von Mensch zu Mensch übertragbar ist, war aus Afrika schon lange bekannt. Außerhalb Afrikas sind Infektketten von diesem Ausmaß bisher jedoch neu. Die Gründe dafür sind noch unklar, haben aber wahrscheinlich viel mit dem menschlichen Verhalten zu tun. Die weltweite Ausbreitung des Erregers ist sehr wahrscheinlich eine direkte Folge der Globalisierung, durch die infizierte Reisende das Virus sehr schnell auch in weit entfernte Gebiete tragen.
Warum und wie hilft der Pocken-Impfstoff gegen das Virus?
Die Pocken, eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt, sind nach einer erfolgreichen weltweiten Impfkampagne seit 1979 ausgerottet. Da das Pocken-Virus und das weit weniger gefährliche Affenpocken-Virus sich relativ ähnlich sind, schützt die Pocken-Impfung auch vor den Affenpocken. Für Menschen, die nach 1979 geboren sind und keine reguläre Pockenimpfung mehr erhalten haben, steht derzeit ein neuerer Impfstoff gegen Pocken und Affenpocken zur Verfügung, der auf einem abgeschwächten Virus basiert und daher weniger Nebenwirkungen hat als der ursprüngliche Impfstoff.
Wie kann die One-Health-Forschung Pandemien künftig verhindern?
Der Mensch dringt immer weiter in tierische Lebensräume ein, Kontakte zu Wildtieren und ihren Krankheitserregern werden häufiger, das Risiko für Zoonosen, also Krankheitsübertragung vom Tier auf den Menschen, steigt. Diese Entwicklung können wir nur eindämmen, indem wir die Gesundheit von Menschen, Tier und Umwelt als ein großes Ganzes betrachten. Diesen Ansatz verfolgt die One-Health-Forschung: Sie untersucht die Ursachen von Pandemien und leitet daraus Maßnahmen ab, mit denen wir künftige Pandemien verhindern können oder zumindest besser auf sie vorbereitet sind. Zum Beispiel hilft engmaschiges Monitoring von Infektionsfällen örtlich begrenzte Epidemien möglichst früh zu erkennen und dadurch die weitere Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Dafür müssen bisher separate Bereiche wie Gesundheit, Landwirtschaft, Klima- und Naturschutz besser miteinander vernetzt, Gesundheitssysteme gestärkt und digitale Frühwarnsysteme etabliert werden.
Quellen
[1] Robert Koch Institut (RKI)
[2] Institut für Virusdiagnostik (IVD)
Kontakt
Prof. Dr. Fabian Leendertz
Dr. Stephanie Markert
Helmholtz-Institut für One Health (HIOH)
hioh-prhelmholtz-hiohde
Vulkanausbrüche
Was bedeutet die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha-apai für Atmosphäre und Klima?

Vulkanausbrüche – Messung und Auswirkung
Vulkanausbrüche stellen eine der größten Unsicherheiten für Klimaveränderungen auf Zeitskalen von einigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt dar. Gleichzeitig sind Vulkanausbrüche für die Forschung hochinteressante natürliche Experimente, mit denen sich die Reaktion des Erdsystems auf eine plötzliche Veränderung untersuchen lässt. Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die Atmosphäre zu überwachen. Boden- sowie Satelliten-basierte Messsysteme stellen Informationen über die Art, Menge und Höhe der ausgestoßenen Vulkangase sowie die Höhe der Aschewolke bereit. Viele nationale Wetterdienste verfügen über die technischen Möglichkeiten, um bereits kurz nach einem Ausbruch die zeitliche und räumliche Ausbreitung der Vulkanasche vorherzusagen und Warnungen für den Flugverkehr herauszugeben.
Für die klimatischen Auswirkungen eines Vulkanausbruchs ist es entscheidend, ob vulkanische Gase (insbesondere Schwefelverbindungen) bis in die Stratosphäre, also in Höhen von mehr als ca. 15 km, injiziert werden. Schwefelverbindungen werden in Schwefelsäure- oder Sulfataerosole umgewandelt, die sich mehrere Jahre in der Stratosphäre aufhalten können. Sie streuen verstärkt Sonnenstrahlung zurück ins All, erhöhen somit das planetare Rückstreuvermögen und können zu einer Abkühlung der Erdoberfläche führen.
Die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai
Am 15. Januar 2022 ereignete sich eine spektakuläre Eruption des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in der pazifischen Inselgruppe Tonga. Die außergewöhnliche Explosivität der Eruption des Hunga Tonga führte zu einer ungewöhnlich starken Druckwelle, die sich mit Schallgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitete und die mit einer Amplitude von 1,5 hPa etwa 12 Stunden später mit Barometern auch in Deutschland detektiert werden konnte (der Bodendruck der gesamten Atmosphäre liegt bei ca. 1000 hPa, also ein Effekt im Promillebreich, aber dennoch gut messbar und für ein einzelnes Ereignis ein großer Effekt).
Nach dem aktuellen Kenntnisstand werden die klimatischen Auswirkungen der Eruption des Hunga Tonga eher klein bleiben. Dies liegt insbesondere an der mit etwa 0,4 Megatonnen vergleichsweise geringen Menge Schwefeldioxid (SO2), die die Stratosphäre erreicht hat. Bei der Eruption des Mount Pinatubo im Juni 1991 – die zu einer Reduktion der global gemittelten Erdoberflächentemperaturen von etwa 0,5 °C über einen Zeitraum von einem Jahr geführt hat – wurden etwa die 20-fache Menge an SO2 in die Stratosphäre eingetragen.
Erkenntnisse für die Forschung
Dennoch ist die Hunga Tonga Eruption für die aktuelle Forschung von großem Interesse, insbesondere, weil der Eintrag vulkanischer Asche und Gase mit etwas über 50 km ungewöhnlich große Höhen über der Erdoberfläche erreicht hat. Die Frage, welche Höhe vulkanisches Material bei einer Eruption erreichen kann, ist noch immer nicht vollständig geklärt. Im Falle der Eruption des Hunga Tonga war der Grund für die große Höhe sehr wahrscheinlich, dass die Eruption unter Wasser stattfand. Diese so genannten phreatomagmatischen Eruptionen, bei denen Magma direkt mit Wasser in Kontakt kommt, sind besonders explosiv. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Eigenschaften der Hunga Tonga Eruption 2022 wird sie sicherlich für viele Jahre Gegenstand der Forschung bleiben
Ansprechpartner
Prof. Dr. Christian von Savigny
mRNA-Impfstoffe gegen Corona
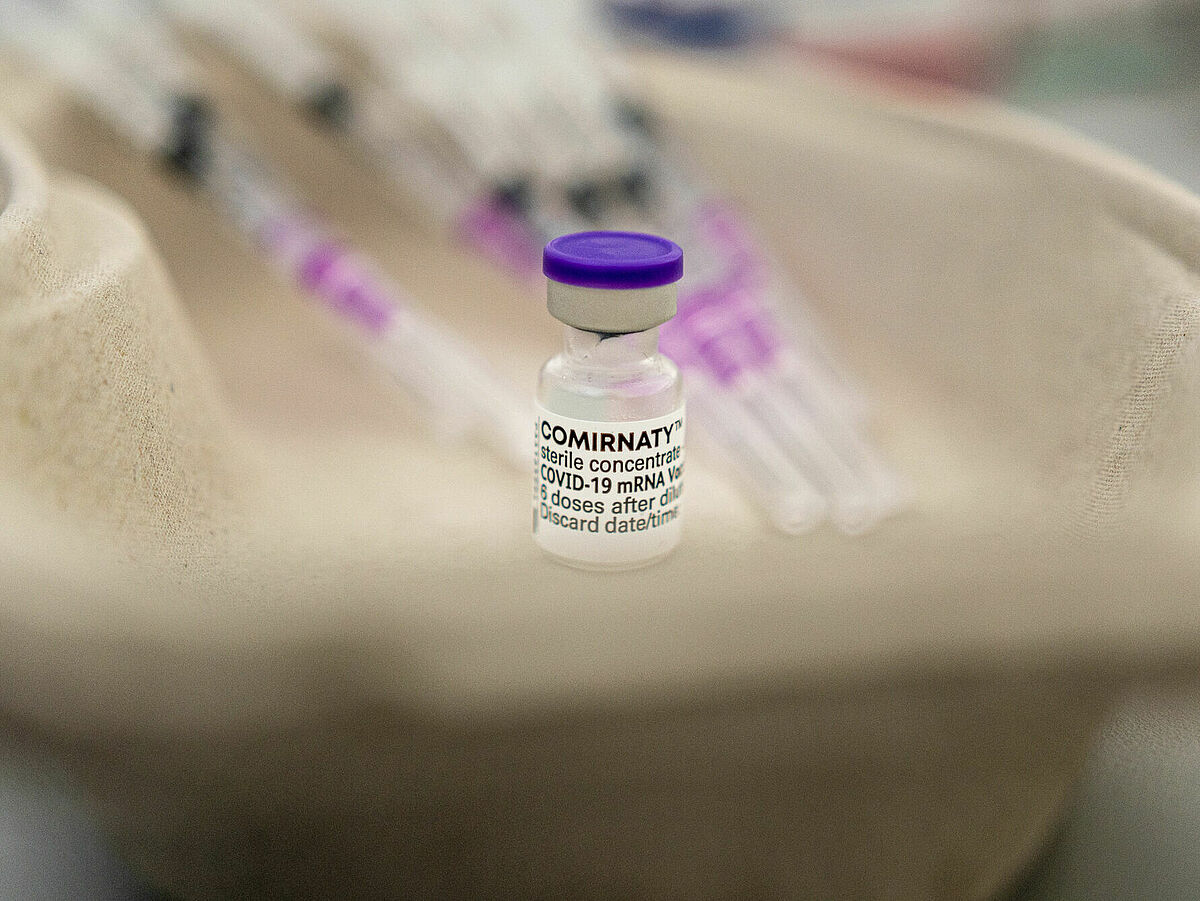
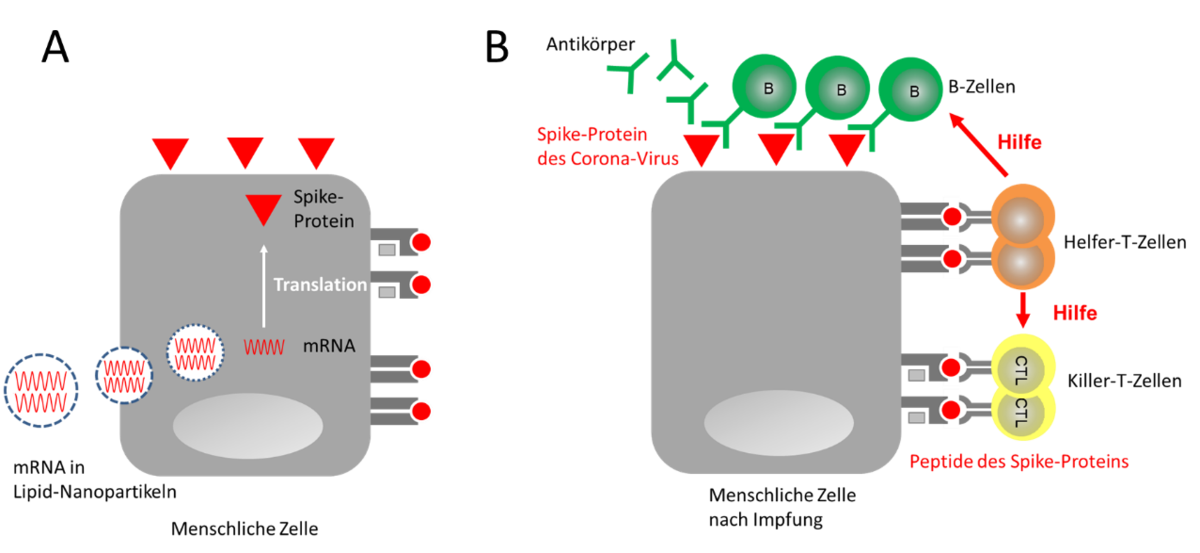
Die Corona-Pandemie ist für uns alle ein harter Stresstest. Das Virus und die pandemische Lage sind dynamisch, dauernd ändert sich etwas, und wir müssen mit Sorge, Widersprüchen und großen Unsicherheiten umgehen lernen. Aktuell werden harte Auseinandersetzungen über die Notwendigkeit einer ersten, zweiten und dritten Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geführt.
Prof. Dr. Barbara Bröker ist Immunologin, dreimal geimpft und gehört zur großen Mehrheit der Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen, die diese Impfungen empfehlen. Im „Fakt der Woche“ beantwortet sie ein paar häufige Fragen zu mRNA-Impfstoffen auf dem aktuellen Wissensstand (7. Dezember 2021).
Warum schützt eine Corona-Impfung vor schweren Krankheitsverläufen?
Nach der Infektion vermehrt sich das Coronavirus SARS-CoV-2 rasend in den Zellen des Nasen-Rachenraums, verbreitet sich im gesamten Organismus und befällt praktisch alle Organe. Weil die ersten Immunantwort gegen das Virus Zeit braucht, kommt sie zu spät, um dies zu verhindern. Die Viren selbst, aber auch die starke Entzündungsreaktion, mit der das Immunsystem die vielen infizierten Zellen angreift, schädigen die Organe, unter anderem die Lunge. Darum ist lebensbedrohliche Atemnot typisch für eine schwere Infektion mit dem Coronavirus.
Aber das Immunsystem ist ja berühmt für seine Lernfähigkeit: auf eine zweite, dritte, vierte … Begegnung mit demselben Virus reagiert es viel schneller und effizienter als auf die erste. Die Viren können sich dann nicht so stark vermehren, und die Krankheitssymptome sind milder. Bei der Corona-Impfung stößt man den immunologischen Lernprozess mit einer harmlosen Substanz an, einem mRNA-Molekül, das nur das virale Spike-Protein kodiert. So wird das Immunsystem trainiert, ohne dass ein gefährliches Virus im Spiel ist. Vollständig geimpft und geboostet kann das Immunsystem bei Konfrontationen mit dem Coronavirus die starke Virusvermehrung verhindern und vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen.
Wie wirkt ein mRNA-Impfstoff?
mRNA-Impfstoffe sind Totimpfstoffe ebenso wie die üblichen Protein-basierten Impfstoffe. Jedoch werden nicht die viralen Proteine selbst appliziert, sondern stattdessen mRNA, deren Sequenzinformation von den Zellen des Organismus in Proteine übersetzt wird. Nach Impfung mit einem Coronavirus-mRNA-Impfstoff können einige Zellen das virale Spike-Protein bilden. Sie zeigen es den Immunzellen, die dann den Immunschutz aufbauen. Für einen guten Schutz müssen verschiedene Typen von Immunzellen zusammenwirken: Antikörper-produzierende B-Zellen, Killer-T-Zellen und Helfer-T-Zellen. Sie alle werden bei einer mRNA-Impfung auf die passende Weise angesprochen (Abb. 1).
Welche gesundheitlichen Gründe sprechen gegen eine Corona-Impfung?
Praktisch keine.
SARS-CoV-2 ist hoch infektiös; niemand kann dem Virus auf Dauer ausweichen. Für alle ist es deshalb wichtig, ihr Immunsystem durch Impfung auf die Konfrontation mit dem Corona-Virus vorzubereiten.
Auch für folgende Personen wird die Impfung nachdrücklich empfohlen:
- Schwangere (ab dem 2. Trimenon), Stillende und Frauen mit Kinderwunsch. Leider erhöht eine Schwangerschaft das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 stark. Dies gefährdet auch das ungeborene Kind. Am besten ist es natürlich, sich bei Kinderwunsch bereits vor einer Schwangerschaft impfen zu lassen. [1]
- Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Viele werden immunsuppressiv behandelt und sind durch das Corona-Virus besonders gefährdet. [2], [3]
Für die wenigen Ausnahmen von der allgemeinen Impfempfehlung zitiere ich aus dem Aufklärungsbogen des Robert Koch Instituts:
„Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) sind jedoch kein Grund zur Verschiebung. […] Wer nach der 1. Impfung eine allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung nicht erhalten.“ [4]
Wie entstehen Mutationen von Viren und warum können diese gefährlich sein?
Bei der Vermehrung von Viren muss ihre Erbinformation molekular kopiert werden. Dabei passieren immer wieder Fehler; das sind die Mutationen. Solche „Kopierfehler“ sind unvermeidlich, alle Viren mutieren. Der Zufall bestimmt, welche Mutationen auftreten. Die allermeisten sind unbedeutend, oder sie schwächen das Virus.
Sehr selten verschafft eine Mutation dem Virus einen Vorteil, z.B. weil es sich leichter übertragen lässt oder die Immunabwehr unterlaufen kann (Immunescape). Dann setzen sich die mutierten Viren gegen andere durch und dominieren im Laufe der Zeit das Geschehen. Es liegt auf der Hand, dass Virusvarianten, die leichter übertragen werden, die Pandemie besonders anheizen. Sorgen bereiten ebenfalls Mutationen, die bei Genesenen und Geimpften Covid-19 verursachen können, weil der Immunschutz, den diese gegen eine ältere Virusvariante aufgebaut haben, gegen die neue schlechter wirkt. Nach dem aktuellen Stand des Wissens schützt eine zweifache Impfung plus Auffrischungsimpfung (Boost) bei allen bekannten Coronavirus-Varianten sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf. „Sehr gut“ bedeutet leider nicht „perfekt“ – das gibt es in der Natur nicht.
Weiterführende Informationen
Quellen:
[1] Empfehlungen der STIKO für Schwangere, Stillende und Frauen mit Kinderwunsch:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Schwangere_Stillende.html
[2] Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zur Impfung gegen SARS-CoV-2 bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen:
https://dgrh.de/Start/Wissenschaft/Forschung/COVID-19/Impfung-gegen-SARS-CoV-2-f%C3%BCr-Menschen-mit-rheumatischen-Erkrankungen.html
[3] Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zur Auffrischimpfung (Boost) gegen SARS-CoV-2:
https://dgrh.de/Start/Wissenschaft/Forschung/COVID-19/Stellungnahme-Covid-19-Auffrischimpfung.html
[4] Robert Koch Institut: Aufklärungsmerkblatt zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen gegen SARS-CoV-2:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Barbara Bröker
Multiresistente Keime im Abwasser
Infektionskrankheiten, die durch antibiotikaresistente Keime verursacht werden, spielen sowohl für die Medizin als auch für die Gesellschaft eine immer größere Rolle. [1] Bestehende Behandlungsmöglichkeiten mit bewährten Antibiotika verlieren zunehmend ihre Wirkung. Doch wo entstehen Resistenzen? Und wie verbreiten sie sich?
Wo entstehen Resistenzen
Resistenz bezeichnet die Fähigkeit, widerstandsfähig gegenüber gewissen äußeren Einflüssen zu sein. Ein übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch antibiotischer Substanzen fördert die Selektion von Bakterien und führt damit auch zu Anpassungen in den Bakterienzellen. Einige Bakterien werden dadurch gegen bestimmte Antibiotika resistent. [2] Neben der natürlichen Verbreitung von antibiotikaresistenten Keimen spielt der Mensch eine entscheidende Rolle, beispielsweise mit der Massenproduktion von Fleisch.
Der weltweite Fleischkonsum steigt stetig an, die Fleischpreise aber bleiben niedrig. [3] Das geht oft einher mit Massenproduktion, schlechten Haltungsbedingen sowie dem bedenkenlosen Einsatz von Medikamenten. Dabei wird nicht selten auf Reserveantibiotika, wie beispielsweise Colistin, zurückgegriffen. Dies sind Anti-Infektiva, welche primär als „letzte medizinische Chancen“ gegen Infektionskrankheiten eingesetzt werden sollten. [4, 5]
Warum Schlachthöfe wesentlich dazu beitragen, Gewässer mit multiresistenten Keimen zu verunreinigen
In der Tierhaltung sind antibiotikaresistente Bakterien keine Seltenheit. Von den Ställen über die Schlachtung bis hin zum Fleischerzeugnis: die Keime sind entlang der gesamten Lebensmittelkette zu finden. [6] Während der Schlachtung werden Tierkörper, Schlachtbesteck und Maschinen gründlich gereinigt. Dabei fallen unzählige Liter Abwasser an, welches mit antibiotikaresistenten Keimen verunreinigt sein kann und in die Kanalisation gespült wird. Von dort aus gelangt das Abwasser entweder in eine Kläranlage oder, unter Einhaltung bestimmter Grenzwerte, direkt in die Umwelt. [7]
In Zusammenarbeit mit Greenpeace e.V. haben Forschende der Pharmazeutischen Mikrobiologie der Universität Greifswald im vergangenen Jahr Abwasserproben von vier Schweine- und drei Geflügelschlachthöfen analysiert. Die Proben wurden entweder direkt am Auslass des Klärwerks des Schlachthofes oder etwas flussabwärts davon genommen. Im Fokus der Untersuchungen standen vor allem die Colistin-resistenten Enterobakterien und die ESBL-produzierenden Escherichia coli. ESBL steht für Extended-Spectrum beta-Lactamasen. Bakterien, die solche Enzyme bilden, können resistent gegen bestimmte Vertreter der sogenannten Beta-Laktam-Antibiotika sein. Insgesamt waren von den untersuchten Bakterien 78 Prozent multiresistent und damit widerstandfähig gegen mindestens drei verschiedene, wichtige Antibiotikaklassen. Alle ESBL-Isolate aus den Geflügelschlachthöfen waren multiresistent. Gegenüber Colistin waren 36 Prozent aller isolierten Bakterien resistent. Außerdem wurde ein multiresistenter Klebsiella pneumoniae-Stamm als starker Biofilmbildner charakterisiert. Durch diese Oberflächenstruktur könnten die Bakterien wesentlich höhere Antibiotikakonzentrationen tolerieren. [8]
Die Untersuchungen zeigen, dass Schlachthöfe einen wesentlichen Anteil bei der Verunreinigung von Gewässern mit multiresistenten Erregern haben können. Die Behandlung von Abwässern sollte daher unter mikrobiologischen Gesichtspunkten neu bewertet werden.
Weiterführende Informationen:
Homeier-Bachmann T, Heiden SE, Lübcke PK, Bachmann L, Bohnert JA, Zimmermann D, Schaufler K. Antibiotic-Resistant Enterobacteriaceae in Wastewater of Abattoirs. Antibiotics 2021 May 12;10(5):568. doi: 10.3390/antibiotics10050568.
Quellen:
[1] World Health Organization. Antimicrobial Resistance Global Report on Surveillance; WHO: Geneva, Switzerland, 2014.
[2] Robert Koch Institut - Grundwissen Antibiotikaresistenz. www.rki.de/DE/Content/Infekt/Antibiotikaresistenz/Grundwissen/Grundwissen_inhalt.html. Zugriff 16 Juni 2021.
[3] Godfray HCJ, Aveyard P, Garnett T, Hall JW, Key TJ, Lorimer J, et al. Meat consumption, health, and the environment. Science 2018. doi:10.1126/science.aam5324.
[4] Köck R, Cuny C. [Multidrug-resistant bacteria in animals and humans]. Review Med Klin Intensivmed Notfmed 2020 Apr; 115(3):189-197. doi: 10.1007/s00063-018-0487-x
[5] Woolhouse, M.; Ward, M.; van Bunnik, B.; Farrar, J. Antimicrobial Resistance in Humans, Livestock and the Wider Environment. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2015, 370, 20140083.
[6] Klees S, Effelsberg N, Stührenberg B, Mellmann A, Schwarz S, Köck R. Prevalence and Epidemiology of Multidrug-Resistant Pathogens in the Food Chain and the Urban Environment in Northwestern Germany. Antibiotics 2020. doi:10.3390/antibiotics9100708
[7] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung - AbwV) Anhang 10 Fleischwirtschaft. o. J. www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_10.html. Zugriff 16 Juni 2021.
[8] Homeier-Bachmann T, Heiden SE, Lübcke PK, Bachmann L, Bohnert JA, Zimmermann D, Schaufler K. Antibiotic-Resistant Enterobacteriaceae in Wastewater of Abattoirs. Antibiotics 2021 May 12;10(5):568. doi: 10.3390/antibiotics10050568.
Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Katharina Schaufler
Recht reden: Jura und Rhetorik – Was gute Reden ausmacht
Das Jurastudium ist durch Schriftlichkeit und damit Schriftsprache geprägt. Studierende lernen, Gutachten, Klausuren oder Hausarbeiten richtig zu verfassen. Mündliche Äußerungen spielen während des Jurastudiums eine untergeordnete Rolle. Daher sind viele Jurastudierende weniger geübt in der Redekunst.
Die juristische Berufspraxis ist viel stärker durch Mündlichkeit geprägt als das Jurastudium. Zu den wesentlichen Aufgaben juristischer Berufsfelder gehört es, Rechtskonflikte präventiv zu vermeiden oder interessengerecht beziehungsweise ausgleichend zu lösen. Dabei genügt es jedoch nicht, Normen und Definitionen eines Rechtsgebiets sowie Argumente verschiedener Meinungen zu kennen und die relevanten Gesetze methodisch richtig anzuwenden. Um in neuen Konfliktfällen eine Entscheidung vertreten zu können, müssen Jurist*innen auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Interessen durch welche Normen geschützt werden und wie sie in welchen Fallkonstellationen darzustellen sind. Das setzt die Kenntnis über die Wirkung von Argumentationsformen sowie die Fähigkeit zur Schwerpunktsetzung, zur schlüssigen Strukturierung und zum reflektierten Umgang mit Sprache voraus.
Juristische Praktiker*innen müssen wirkungsorientiert sprechen können. Sie müssen Adressat*innen also überzeugen können und auf Körperkommunikation, Sprech- und Sprachausdruck achten. Sie müssen eine Auffassung auch mündlich glaubwürdig darstellen und die eigenen Argumente verständlich und schlüssig artikulieren können. Daher kommen Jurist*innen nicht ohne rhetorisches Handwerkszeug und ein rhetorisch geschultes Bewusstsein aus.
Was macht eine gute Rede aus?
Vorträge sind durch Kurzlebigkeit und Flüchtigkeit der Äußerungen gekennzeichnet. Dabei werden mehrere Wahrnehmungskanäle des*der Rezipienten*in angesprochen: der akustische mit der Verarbeitung der Laute und der stimmlichen Merkmale und der optische mit den körperlichen Signalen (Mimik, Gestik, Haltung, Raumverhalten). Mündliche Verständigung findet auf mehreren Ebenen gleichzeitig statt. Die Kommunikationswissenschaft spricht von der „Simultanität oder Multimodalität“ mündlicher Kommunikation.
Gute Redner*innen berücksichtigen, dass Hörer*innen besonders zu Beginn einer Kommunikationseinheit sehr viele Reize verarbeiten. Sie werden die Hörer*innen nicht mit wichtigen Informationen gleich zu Sprechbeginn überfordern, sondern durch eine Hinführung und Einstimmung „abholen“. Sie halten ihre Sätze strukturell eher einfach und kurz, wiederholen die wichtigsten Aussagen mit anderen Worten und fassen Inhalte zusammen. Kompetente Redner*innen setzen unterschiedliche Signale stimmig und die Körpersprache unterstützend ein. Versierte Redner*innen verzichten auf Floskeln wie „nicht außer Acht zu lassen ist auch, dass …“. Sie sagen stattdessen mit klaren Worten, was Sache ist.
Eine gute Rede hat eine für den*die Hörer*in unmittelbar nachvollziehbare, offensichtliche Struktur. Ein strukturierter Redeablauf gehört zum ältesten Postulat rhetorischer Lehrtheorie. Vom Anbeginn der Rhetorikgeschichte gliedern sich Reden grob in einen Anfangsteil (exordium), einen Hauptteil – und seinen Untergliederungen – sowie einen Schlussteil (peroratio). Die antike Gerichtsrede untergliedert den Hauptteil weiter in die Darlegung des Sachverhalts (narratio), die Beweisführung (der eigenen rechtlichen Bewertung = argumentatio) sowie die Auseinandersetzung / Entkräftung mit den Argumenten der Gegenseite (refutatio; lat. refuto = ich weise zurück).
Bei einem Sachvortrag ist die sogenannte AIDA-Formel des Redeanfangs empfehlenswert. Sie stammt ursprünglich aus dem Marketing. Hinter dem Kürzel verbergen sich die englischen Worte: A wie „attention“, I wie „interest“, D wie „desire“ und A wie „action“. Am Anfang des Vortrags ist es danach wichtig, die Relevanz des Themas deutlich zu machen (= attention, interest), das Thema in den wissenschaftlichen Kontext einzuordnen und die Neugier auf den Hauptteil zu wecken (= desire) sowie einen – am besten nummerierten – Überblick über die anzusprechenden Aspekte zu geben (= action). Der Schluss einer Rede soll wie der Schlussakkord eines Musikstücks beim Publikum nachhallen, denn den letzten Gedanken nimmt das Publikum mit aus dem Saal.
Für die Konzeption einer wirkungsvollen juristischen Rede hat die Rhetorik mit der sogenannten IDEMA-Formel oder den fünf Produktionsstadien ein strukturiertes System geschaffen. Auf die Formel stützen sich Redner*innen seit der Antike bei der Planung einer Rede oder eines wichtigen Gesprächs.
- Im ersten Stadium wird die Redesituation und die Redeabsicht analysiert. Nur wer Adressat*innen und Redeziel kennt, kann Äußerungen wirkungsvoll planen. Die antike Gerichtsrede hat mit der sogenannten Statuslehre einen Katalog von Fragen entwickelt, die an einen Rechtsfall gestellt werden. Mit ihnen erschlossen sich antike Redner, wofür sie vor Gericht eintreten wollten.
- Wenn die zielführenden Inhalte gefunden sind, müssen sie im zweiten Schritt in eine nachvollziehbare gedankliche Ordnung gebracht werden, so dass sie von den Hörer*innen gut aufgenommen und verarbeitet werden können. Hierbei dient bis heute der Aufbau der antiken Gerichtsrede als strukturelles Vorbild.
- In einem dritten Schritt müssen passende und für das Publikum verständliche Formulierungen überlegt werden.
- Die konzipierte Rede wird im vierten Schritt so aufbereitet (z. B. in Manuskriptform), dass sie frei und ohne Brüche vorgetragen werden kann.
- Im letzten Stadium, dem Redeauftritt, geht es dann um die adäquate und souveräne Körperkommunikation und um stimmliche Mittel, die im Einklang zum Gesagten stehen.
Die IDEMA-Formel zeigt auch: Nonverbale Kommunikation und freie Rede – auf die die Rhetorik oft verkürzt wird – machen nur einen Teil der Rhetorik aus.
Weitere Informationen:
Thilo Tröger: Rhetorik für Juristen. Recht reden, Baden-Baden 2021.
„Es muss nicht immer ‚käuflich erwerben‘ heißen“ (FAZ-Artikel v. 04.08.2021).
Ansprechpartner:
Thilo Tröger
Fake News einfach aufgedeckt
Die Corona-Pandemie begleitet die Gesellschaft über ein Jahr und entfesselte durch die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Verbreitung große Gegenwehr aus diversen Ecken der Bevölkerung. Einige beschweren sich über zu wenig Luftzufuhr durch das Tragen medizinischer Masken, andere haben Probleme mit Homeoffice und Kurzarbeit – soweit verständliche Argumente. Wieder andere sehen hinter der Pandemie nichts weiter als eine große Lüge der internationalen politischen und wirtschaftlichen Eliten zur Sicherung ihrer finanziellen Interessen. Sie leugnen die Existenz des Corona-Virus. So fordere das Virus auch keine Opfer. Die Beweise dafür liefern Corona-Leugner scheinbar direkt mit.
In den sozialen Medien tummelt sich aktuell eine große Anzahl derer, die mit vereinter Kraft und Belegen aus oberflächlichen Recherchen das Ziel verfolgen, „die große Lüge“ über die fingierte Corona-Pandemie aufzudecken. Dabei stellen sie ihre angeblich investigativen Belege online zur Schau. Ein von den Berliner Bloggern vom „Volksverpetzer“ aufgedecktes Beispiel zeigt deutlich, dass bei der Online-Recherche Vorsicht und gesunde Skepsis geboten ist. Ein unbekannter User lädt ein offizielles Bild hoch, auf dem mehrere schwarze Leichensäcke öffentlich nebeneinander ausgelegt wurden – angeblich Corona-Tote. Auf dem Bild ist ein Detail zu erkennen, welches die Nutzer*innen zur klaren Schlussfolgerung verleiten soll, dass die Leichensäcke dazu dienen, die Bevölkerung durch die Medien zu manipulieren. Eine Frau trägt im Hintergrund einen der Säcke mit scheinbar müheloser Leichtigkeit durch das Bild. Aus dieser Beobachtung sollen Nutzer*innen eine Verschwörung ableiten. Kommentiert wurde der Post wie folgt: „Pandemie oder großer Schwindel?“.
Die Antwort ist schnell gefunden und bedarf lediglich einer Rückwärtssuche des Bildes bei Google. Diese ergibt klar, dass die Säcke Teil eines symbolischen Trauerzuges der amerikanischen Gruppe „New Florida Majority“ (NewFM) waren. Die Gruppe hat also nie behauptet, dass die Säcke echt seien. Die von der NewFM organisierte Demonstration diente der Erinnerung an die 100 000 Corona-Toten in den USA und forderte unter anderem finanzielle Hilfen für die vielen pandemiebedingten Arbeitslosen.
Kurz gesagt: Der Post des Bildes mit der Frau, die scheinbar einen Leichensack trägt, sollte eine vermeintliche Manipulation aufdecken. Dieser konkrete Fall kann auf viele Erscheinungen von Fake News im Internet übertragen werden. Oft haben Falschmeldungen eines gemeinsam: Sie zeichnen ein falsches Bild der Wirklichkeit und führen Menschen absichtlich in die Irre – meist unter der Prämisse, ein bestimmtes ideologisches Narrativ zu füttern, wie die oft von rechtspopulistischer Seite unterstellte globale „Corona-Lüge“. Auch ein weiteres Phänomen der Fake News wird anhand des Posts gut illustriert. Die Tatsache, dass sie oft nicht gänzlich erfunden sind. Durch das Weglassen wichtiger Informationen, wie hier die Anmerkung, dass es sich bei dem Bild um einen symbolischen Trauerzug handelt, oder die verzerrte Darstellung eines Sachverhalts wird die Realität falsch dargestellt. Problem des Ganzen ist, dass Fake News durch soziale Medien in kürzester Zeit hunderttausendfach verbreitet werden können.
Es war nie leichter, Hass und Hetze mit wenigen Klicks viral gehen zu lassen und gesellschaftliche Spaltungen voranzutreiben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Beiträge aus dem Internet genau zu prüfen, bevor sie gedankenlos geteilt werden. Dazu sollten Quelle kontrolliert oder Absichten hinter den Posts kritisch hinterfragt werden. Oft dienen Fake News bestimmten Interessen wie der Generierung von möglichst vielen Klicks und Geld oder der Polarisierung und Verunsicherung der Gesellschaft. Manipulation durch Fake News kann jeden Menschen treffen, weshalb eine kritische Auseinandersetzung mit den Falschmeldungen und eine Stärkung der eigenen Medienkompetenz unabdingbar sind.
Weitere Information
Bis zum 27. Juli 2021 können Interessierte in der STRAZE eine Ausstellung zum Thema „Fake News“ besuchen.
Ansprechpartnerin
Finja-Pauline Schöbel
Warum Forschende unter Tage nach dem Wald der Zukunft suchen


Es ist nur ein kleines Loch im Boden in einem Fichtenwald irgendwo im Erzgebirge. Viele Jahrhunderte ist hier niemand eingestiegen. Jetzt werden einige der zahlreichen mittelalterlichen Silbergerbwerke erkundet. Archäolog*innen bergen einen Stützbalken. Anhand des charakteristischen Jahrringmusters kann das genaue Alter seiner Fällung und somit das Alter der Stollen bestimmt werden. Dieser hier stammt aus dem 12. Jahrhundert. Der letzte Jahrring datiert auf das Jahr 1152 AD. Es ist eine Weißtanne. Sie war damals in der Höhenstufe von circa 400 Metern die dominierende Baumart in den noch natürlichen Wäldern. Später wandelt sich das Bild. Mit zunehmender Übernutzung kommen auch Fichten-, Ahorn- oder Buchenholz zum Einsatz. Deren Holz ist eigentlich weniger gut zum Abstützen der Stollen geeignet. Das Holz knarrt nicht bei Überlastung – eine wichtige Eigenschaft. Damit konnten sich Bergleute früh genug in Sicherheit bringen, bevor ein Stollen instabil wurde. Heute ist die Weißtanne – vom sauren Regen der 1980er Jahre stark geschädigt – weitestgehend aus den Wäldern des Erzgebirges verschwunden. Sie wird jedoch vermehrt wieder aufgeforstet. Anders als die Fichte, die aufgrund der Trockenheiten der letzten Jahre extrem vom Borkenkäfer befallen ist und großflächig abstirbt, bleibt die Tanne von den Borkenkäfern verschont.
Doch die alten Holzproben können noch weit mehr verraten. Kleine Holzstücke werden vorsichtig aus den Stützbalken und anderen Grubenfunden herausgesägt und an das dendrochronologische Labor DendroGreif der Universität Greifswald gesandt. Dort werden aus den Proben noch kleinere Streifen herausgesägt. Das Eisen und Mangan aus dem Grubenwasser, das sich über die Jahrhunderte im Holz angereichert hat, wird zunächst extrahiert. Anschließend werden die Proben in einem speziellen Röntgenscanner durchleuchtet. Anhand der Röntgenbilder können neben den Jahrringbreiten auch jährliche Holzdichten bestimmt werden. Besonders interessant ist das Spätholz, der äußere Teil eines Jahresringes. Ist es sehr dicht gepackt, so war der Sommer in dem Jahr sehr warm. Charakteristische Muster in den Jahrringdichten verraten, ob der Baum, aus dem der Holzbalken gesägt wurde, in der Nähe der Grube wuchs oder aus höheren Gebirgsteilen des Erzgebirges zur Grube transportiert wurde. War der Wald im Umfeld der Gruben gerodet, musste Holz von weiter her herangeflößt werden. Eingriffe wie starke Rodungen im Umfeld eines Baumes befreien diesen von der Lichtkonkurrenz. Anhand sprunghaft steigender Jahrringbreiten in den Grubenhölzern können Perioden intensiver Waldnutzung identifiziert werden.
Die Zeit des mittelalterlichen Silberbergbaus fällt in eine klimatische Gunstperiode, das mittelalterliche Klimaoptimum. Es dauerte circa vom 11. bis zum 13.Jahrhundert. Damals waren die Sommer warm und wahrscheinlich auch eher trocken – vergleichbar mit den aktuellen klimawandelbedingten Entwicklungen unseres Wetters. Im Projekt ArchaeoForest wollen Forschende herausfinden, wie ein natürlicher Wald auf diese Klimabedingungen reagiert hat, welche Baumarten dort mit welchen Wachstumsraten dominierten und wie sich die zunehmende Übernutzung auf den Wald auswirkte. Dies soll helfen, heute den Wald zu pflanzen, der auf der einen Seite stabil genug ist, um dem zunehmenden Klimastress zu trotzen, und auf der anderen Seite flexibel genug, um sich den veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Daher sind auch Förster*innen der sächsischen Landesforstanstalt im Projekt ArchaeoForest involviert.
Ansprechpartner*innen
Prof. Martin Wilmking, Dr. Tobias Scharnweber und Svenja Ahlgrimm
AG Landschaftsökologie und Ökosystemdynamik an der Universität Greifswald
Croy-Teppich: Zur Geschichte des textilen Riesenbildes aus Wolle, Seide, Gold- und Silberfäden

Die Universität Greifswald ist Eigentümerin eines Kunstwerks, das als Kulturgut von nationaler Bedeutung eingestuft wurde: dem Croy-Teppich. Es handelt sich dabei um einen über 30 Quadratmeter großen Bildteppich aus der Lutherzeit im 16. Jahrhundert, einem sogenannten Gobelin.
Gobelins waren in der Renaissance und dem Barock ein fester Bestandteil des Hausrats in herrschaftlichen Schlössern und Burgen. Sie kamen dem Bedürfnis der Adelskultur der Zeit nach Mobilität, Dekoration, Repräsentation und geistreichen Bildprogrammen entgegen. Wer einen Fundus aus derartigen Bildteppichen besaß, konnte die kahlen Wände eines lange unbewohnten Flügels des Schlosses schnell prächtig herrichten, das Aussehen eines Fest- oder Audienzsaales verändern oder die Teppiche als kostbare diplomatische Geschenke an andere Fürstenhäuser verwenden. Gobelins waren also Bildmedium, Hausausstattung und Statussymbol zugleich.
Darum verwundert es überhaupt nicht, dass Ernst Bogislaw von Croy – der Neffe des letzten regierenden Pommernherzogs – der damaligen Pommerschen Landesuniversität in Greifswald Ende des 17. Jahrhunderts einen derartigen Prunkteppich vermachte. Das textile Riesenbild aus Wolle, Seide, Gold- und Silberfäden muss als religiöses und politisches Statement des regierenden Hauses gelesen werden: Die durch eine Ehe verbundenen Fürstenhäuser der Herzöge von Pommern und der Kurfürsten von Sachsen sind unter der Kanzel des predigenden Martin Luther versammelt. Das drückt ein klares Bekenntnis zur Reformation aus.
Die Universität hat den Teppich bis heute bewahrt. Er war Teil der im Testament Ernst Bogislaws verfügten Verpflichtung, im 10-Jahres-Rhythmus eine Gedenkfeier für die letzte geborene Pommernprinzessin Anna und damit für das erloschene Herrscherhaus auszurichten. Genau das tun wir bis heute!
Doch wohin mit dem Gobelin, wenn das Schloss dazu fehlt? In früheren Zeiten lagerte die Universität den riesigen Teppich zusammengelegt oder -gerollt im Hauptgebäude. Zu den Croy-Festen sollte er im jeweils größten Auditorium aufgehängt werden. Doch das war problematisch: Das Audimax, der heutige Konferenzsaal in der Domstraße 11, war auf der Seite des früheren Rednerpults zu niedrig, um die Bildfläche vollständig ausbreiten zu können. Folglich zeigte man den Croy-Teppich seit 1750 dort immer mit umgeschlagener Oberkante.
Heute gibt es dieses Problem nicht mehr: Der Croy-Teppich ist konservatorisch sicher und dauerhaft im Croy-Saal des Pommerschen Landesmuseums zu sehen. Am 7. Juli 2021, dem 361. Todestag der Anna von Croy, ist der Eintritt sogar frei.
Weitere Informationen
Zum Croy-Fest
Ansprechpartner
Dr. Thilo Habel
Deutschland auf der Suche nach dem Endlager für hochradioaktiven Abfall – Wie ist der Stand?
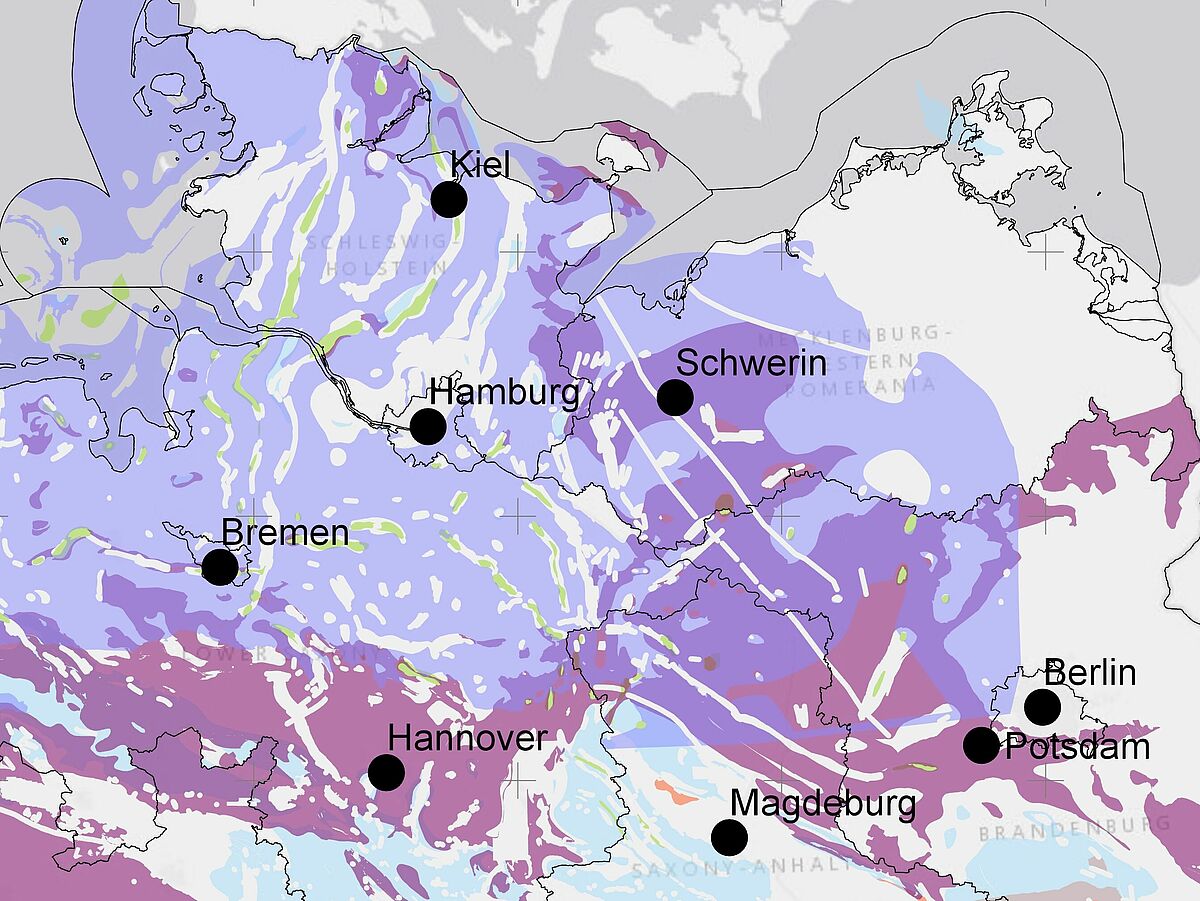
Ende 2022 soll in Deutschland das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Der hochradioaktive Abfall aus Kernkraftwerken muss noch für einen Zeitraum von einer Millionen Jahren im tiefen Untergrund sicher gelagert werden.
Welche Gebiete in Deutschland sind grundsätzlich für ein Endlager geeignet?
Ende September 2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) eine Karte veröffentlicht, in der alle noch im Endlagersuchverfahren enthaltenen Regionen farbig dargestellt sind. Die große Überraschung ist: 54 Prozent der Fläche Deutschlands sind noch im Suchverfahren. Es sind diejenigen Regionen, in denen eines der möglichen Wirtsgesteine (Kristallin- und Tongestein oder Salzablagerungen) in einer Qualität vorkommt, die die Mindestanforderungen an Tiefenposition, Mächtigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Flächenbedarf erfüllt. In diesen Regionen darf es außerdem keine Erdbeben- oder vulkanische Tätigkeit geben. Es darf auch keine weitere Zerrüttung innerhalb des Zeitraums von einer Millionen Jahre zu erwarten sein.
Wie weit sind wir bei der Suche nach geeigneten Endlagern?
Im nächsten Untersuchungsschritt sollen die in der Karte ausgewiesenen, teilweise riesigen Gebiete weiter eingeengt werden. Zuvor wird das momentane Zwischenergebnis sowie die Suchmethoden in drei öffentlichen – coronabedingt digital stattfindenden – Fachkonferenzen erörtert. Dieser Schritt ist, wie das gesamte Suchverfahren, im Standortauswahlgesetz (StandAG) festgeschrieben. Die nächste und letzte der drei Fachkonferenzen findet am 6. und 7. August 2021 statt.
Warum soll sich die Öffentlichkeit an der Suche beteiligen?
Die öffentliche Beteiligung ist einer der fünf Grundpfeiler des Suchverfahrens: Partizipation – Wissenschaftlichkeit – Fairness – Transparenz – Lernendes Verfahren. Lernen soll heißen, die Fehler der siebziger Jahre nicht zu wiederholen. Damals wurden einsame politische Entscheidungen für die Standorte Gorleben (BRD) und Morsleben (DDR) gefällt. In beiden Standorten bilden Salzablagerungen das Wirtsgestein, und sie liegen unmittelbar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Damit in Zukunft bessere Entscheidungen getroffen werden, wird heute die Öffentlichkeit verstärkt in das Suchverfahren eingebunden.
Der derzeitige Stand der Erörterungen lässt sich – sicher noch unvollständig – wie folgt zusammenfassen:
- Eine echte Betroffenheit der Bevölkerung konnte bisher, angesichts der sehr großen ausgewiesenen Fläche, nicht erreicht werden. Die Öffentlichkeit wird auch im nächsten Einengungsschritt kontinuierlich beteiligt. Insbesondere junge Menschen müssen stärker für das Endlagerthema interessiert werden. Sie haben in der Vergangenheit von der Kernkraft kaum profitiert, sind aber in Zukunft mit den Fragen und Problemen konfrontiert, die der hochradioaktive Abfall mit sich bringt.
- Die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen leidet noch an einer mangelnden Zugänglichkeit der verwendeten geologischen Information. Teils ist auch das Grundverständnis der Öffentlichkeit für geologische Sachverhalte nicht ausreichend.
Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald
Prof. Dr. Maria-Theresia Schafmeister
Mitglied des Nationalen Begleitgremiums
Geklaut oder gerettet? – Was der Reliquienraub im Mittelalter und der Parthenon-Fries gemeinsam haben


Die Entführung und Mitnahme wie auch das Behalten und die verweigerte Rückgabe fremden Kulturguts werden in vielen historischen Quellen als heroische Akte des Bewahrens – gar der Rettung – dargestellt, in denen scheinbar interessenlos nur das Wohl des Objekts im Mittelpunkt steht. Oft geht das mit der Abwertung derjenigen einher, aus deren Lebensbereich die Gegenstände entfernt wurden – weil sie sich, im Verständnis der Entführer, nicht um die Werke kümmern könnten oder sie gar zerstören würden.
Ein Beispiel findet sich in einem Bericht des 11. Jahrhunderts über den Erwerb der Reliquien des Heiligen Markus für die Stadt Venedig. Die Gebeine des Heiligen waren in einer Kirche im ägyptischen Alexandria verwahrt, als – so der Bericht – zwei venezianischen Händlern das Gerücht zu Ohren kam, dass die Kirche auf Geheiß des Sultans zerstört werden sollte. Mit einer List erschlichen sie die Ausfuhr der Reliquien aus Ägypten. Die triumphale Ankunft der Reliquien in Venedig wird im Markusdom in vielerlei bildlichen Zeugnissen zelebriert.
Auch der französische Diplomat Benoît de Maillet, der im 18. Jahrhundert eine römische Ehrensäule aus Alexandria (Ägypten) nach Paris bringen lassen wollte, sprach von einer Rettung vor Menschen die „zu grob sind, solche Merkwürdigkeiten zu schätzen“ (1735).
Ebenso lauteten seit dem 19. Jahrhundert britische Argumente im Streit um den Parthenon-Fries, der von Lord Elgin aus Athen nach Großbritannien gebracht wurde. Im Protokoll einer parlamentarischen Befragung von 1816 ist zu lesen, dass die Skulpturen großer Gefahr durch Einheimische ausgesetzt gewesen wären, die Fragmente antiker Skulpturen an Reisende verkauften. Im Wandtext des British Museum, wo die Skulpturen heute ausgestellt sind, heißt es: „Elgin‘s removal of the [Parthenon] sculptures has always been a matter for discussion, but one thing is certain – his actions spared them further damage by vandalism, weathering and pollution.“*
Nicht selten wird auch im Hinblick auf die tagesaktuelle Frage der Restitution von kolonialzeitlichem Kulturgut aus westlichen Museen die Kompetenz der enteigneten Gesellschaften, die Objekte sicher zu verwahren infrage gestellt.
Wenn von Kunstraub und Beutekunst, von kulturellem Erbe, Aneignung, Eigentum und Restitution die Rede ist, sind die Worte politisch oder ideologisch geladen – sie transportieren eine Lesart der Ereignisse, sie verfolgen ein Ziel. Der Fokus zweier kürzlich aus dem Forschungsprojekt translocations erschienener Bücher mit dem Titel Beute – Eine Anthologiezu Kunstraub und Kulturerbe sowie Beute –Ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbeliegt darauf, solche Ziele offenzulegen und wiederkehrende Argumente sowie feststehende Muster – wie die des hier geschilderten „Rettungsnarrativs” – erkennbar zu machen.
Der Blick auf die in beiden Bänden zusammengetragenen Bild- und Schriftzeugnisse aus zweitausend Jahren Menschheitsgeschichte zeigt, dass viele, vielleicht sogar die meisten Argumente um recht- oder unrechtmäßigen Besitz von Kunst- und Kulturgütern nicht neu sind. So stellte der griechische Geschichtsschreiber Polybios im 2. Jahrhundert vor Christus über den Abtransport von Kunstwerken durch die römischen Eroberer seiner Heimat fest: „Ob sie damit richtig und in ihrem eigenen Interesse gehandelt haben, oder ob das Gegenteil der Fall ist, darüber wäre viel zu sagen.“ Er und viele weitere taten es, und zeigten dabei, dass es nicht um Reizwörter und Einzelfälle geht – sondern um eine Grundsatzfrage menschlicher Kultur, die trotz ihres Alters nicht unlösbar bleiben muss.
* „Elgins Demontage der [Parthenon]-Skulpturen war immer ein Diskussionsthema, aber eines ist sicher – sein Handeln hat ihnen weiteren Schaden durch Vandalismus, Verwitterung und Verschmutzung erspart.“
Weitere Informationen
Online-Buchpremiere (25. Mai 2021) mit den Herausgeber*innen
In den Medien
- Interview mit Isabelle Dolezalek (Universität Greifswald) und Merten Lagatz (Technische Universität Berlin), in: SWR2 Kultur am Mittag.
- Von der Antike bis heute: Kulturgüter als Beute, in: Deutsche Welle (auch englisch und spanisch)
- Der lange Schatten der kolonialen Raubkunst, in: Österreichischer Rundfunk
- „Beute“ – Anthologie und Bildatlas | Bénédicte Savoy und Robert Skwirblies, in: ZDF Aspekte
Buchveröffentlichungen
- Isabelle Dolezalek, Bénédicte Savoy, Robert Skwirblies (Hg.): Beute – Eine Anthologie zu Kunstraub und Kulturerbe. Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2021.
Leseprobe aus der Anthologie - Merten Lagatz, Bénédicte Savoy, Philippa Sissis (Hg.): Beute – Ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbe. Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2021.
Leseprobe aus dem Bildatlas
Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald
Prof. Dr. Isabelle Dolezalek
Welchen Zweck haben Staatsfonds?
Staatsfonds stellen Sondervermögen von Staaten dar. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. In ihnen bündeln Länder Geld, um damit später bestimmte Staatsausgaben zu finanzieren. Die angehäuften Vermögen werden beispielsweise zum Ausgleich konjunktureller Schwankungen, zur Förderung von Infrastrukturprojekten oder zur Deckung zukünftiger Pensionszahlungen genutzt.
Die Sondervermögen entstehen, weil Länder in ihrem Territorium beispielsweise auf Öl- oder Gasvorkommen stoßen und diese ausbeuten. Damit nicht nur die aktuelle Generation von den dabei erzielten Gewinnen profitiert, fassen die Länder einen Teil der Gewinne in staatlich verwaltete Sondervermögen zusammen.
Weltweit gibt es rund 90 Staatsfonds, wobei manche Länder mehrere Staatsfonds besitzen. Zwei Drittel der Staatsfonds wurden erst nach 2000 gegründet. Das Volumen mancher Staatsfonds übersteigt inzwischen das Bruttoinlandsprodukt des fondsverwaltenden Landes. Die geballte Finanzkraft von Staatsfonds beunruhigt umso mehr, je weiter die Länder, die Staatsfonds besitzen, im Demokratieindex abrutschen und sich nicht als Demokratien, sondern als Autokratien erweisen.
Die Zweckentfremdung von Geldern der Staatsfonds wird eher dem abrupten Sinneswandel von Autokratien zugeschrieben. Abseits dessen kann die Frage gestellt werden, ob Änderungen in der Zweckbestimmung von Staatsfonds auch in vollständigen Demokratien stattfanden. Spanien und Irland gründeten in den Jahren 2000 und 2001 Staatsfonds, um ihre steigenden Pensionsverpflichtungen zukünftig besser decken zu können. Später wurden die Gelder der Staatsfonds jedoch zweckentfremdet, indem Löcher im Staatshaushalt gestopft (Spanien) oder sie zur Bankenrettung eingesetzt (Irland) wurden.
Die Beispiele Spanien und Irland zeigen, dass vollständige Demokratien gegen eine Zweckentfremdung ihrer Staatsfonds keineswegs immun sind. Selbst wenn die Änderungen in der Zweckbestimmung wie in den beiden vorliegenden Fällen demokratisch legitimiert sind, bleiben erhebliche Vertrauensverluste und das ursprüngliche Problem der Finanzierung steigender Pensionsverpflichtungen ungelöst.
Originalveröffentlichung
Jan Körnert und Thomas Junghanns (2021): Zweckentfremdung von Staatsfonds in Irland und Spanien. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK), Verlag Fritz Knapp, Frankfurt a.M., ISSN 0341-4019, Jg. 74, Heft 11, S. 581–583.
Ansprechpartner
Prof. Dr. Jan Körnert
Wie lernen wir zu argumentieren?

Durch die pandemiebedingten Einschränkungen sind seit über einem Jahr viele Kinder zuhause. Sie gehen nicht mehr in die Kita oder zur Schule, sondern verbringen häufig die meiste Zeit mit ihren Eltern. Aus Spracherwerbsperspektive ist das problematisch, denn die Interaktion der Kinder untereinander fehlt. Diese Begegnungen, die sonst in der Kita oder auf dem Spielpatz stattfinden, haben vielfältige Funktionen. Sie dienen als Lernort für Literacy-Fähigkeiten. Damit sind nicht nur reine Lese- und Schreibkompetenzen gemeint. Der Begriff schließt auch Kompetenzen wie Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Vertrautheit mit Büchern und Schriftsprache ein. Kita-Kinder sammeln also erste Erfahrungen mit Sprache und Sinnverstehen. Da diese Treffen fehlen, mangelt es auch an relevanten Kommunikationsthemen. Normalerweise lernen Kinder argumentieren, wenn sie sich mit bestimmten Sachverhalten auseinandersetzen. Wenn viele dieser Erfahrungen ausbleiben, gibt es keinen Grund, mit anderen zu diskutieren.
Argumentieren ist eine wichtige Praxis in der Kommunikation. Trotzdem ist noch wenig erforscht, wie Kinder lernen, untereinander zu argumentieren. Es wird davon ausgegangen, dass schon Kindergartenkinder bei Konflikten miteinander und voneinander lernen können, mit Streitsituationen umzugehen. Durch die Forschung in diesem Bereich wird herausgearbeitet, was Kinder auf argumentativer Ebene tun. Damit können die Kinder in ihrer Entwicklung besser gefördert und unterstützt werden. Sie können lernen, bereits im Kindergartenalter Konflikte selbstständig und erfolgreich zu lösen und werden auch auf die Anforderungen der Schule vorbereitet.
Weitere Informationen
Arendt, Birte (2019): Argumentieren mit Peers. Erwerbsverläufe und -muster bei Kindergartenkindern. Tübingen: Narr/Stauffenburg Linguistik.
Ansprechpartner
PD Dr. Birte Arendt
Warum die Sonne und der Mond manchmal blau erscheinen
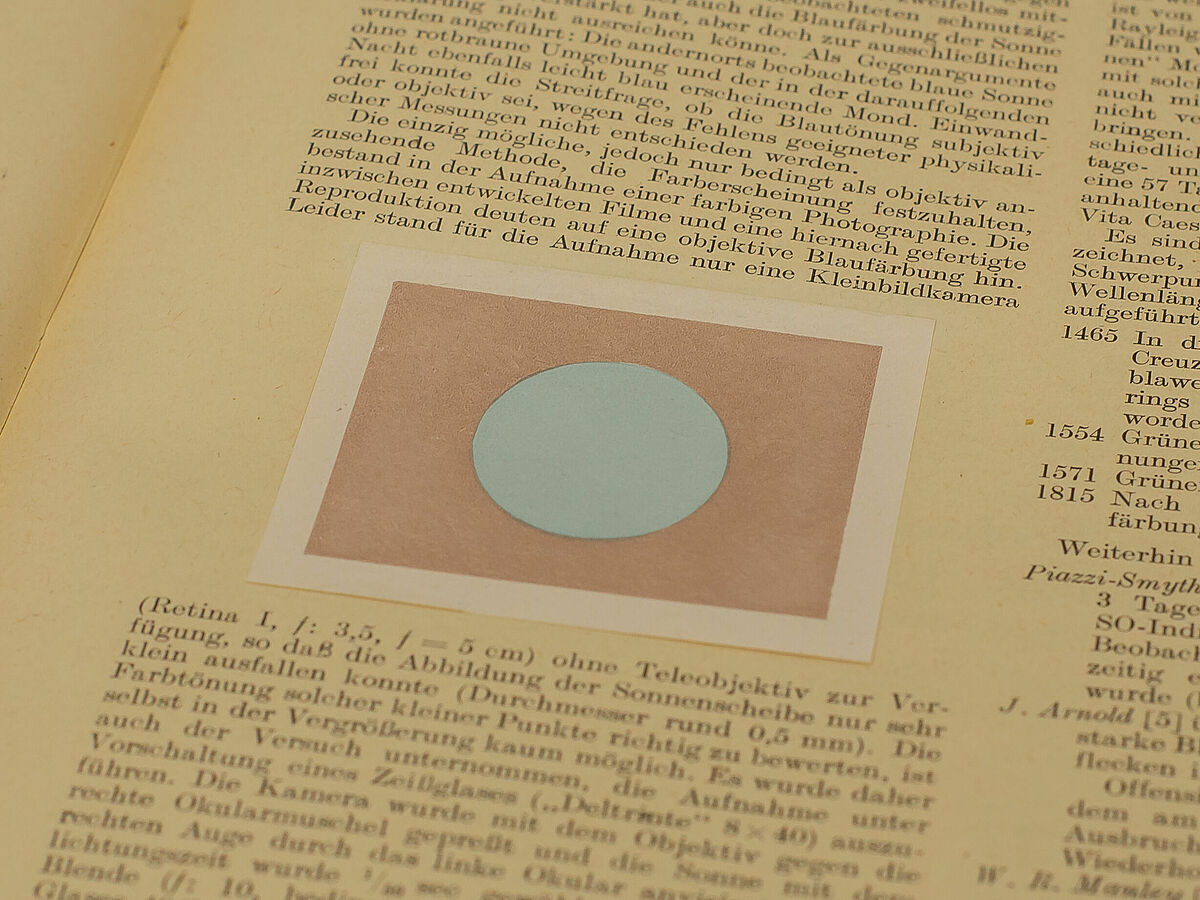
Es kommt nur äußerst selten vor, doch nach Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder Sandstürmen können die Sonne und der Mond blau oder auch grün erscheinen. In Greifswald wurde das Phänomen der blauen Sonne im Jahr 1950 beobachtet und vom Observatorium aus fotografiert. Auch in historischen Überlieferungen finden sich zahlreiche Berichte über diese ungewöhnliche Verfärbung der Sonne. Insbesondere nach dem Ausbruch des Vulkans Krakatoa im Jahr 1883 wurde das Phänomen der blauen Sonne an vielen Orten beobachtet und dokumentiert.
Wir können jeden Tag beobachten, wie sich die Sonne verfärbt. Steht die Sonne hoch am wolkenfreien Himmel, so erscheint sie uns gelblich. In Nähe des Horizonts färbt sie sich meist orange-rötlich. Diese alltägliche Verfärbung der Sonne wird hauptsächlich auf die sogenannte Rayleigh-Streuung des Lichts an Luftmolekülen zurückgeführt. Das Spektrum des Sonnenlichts vereint bekanntlich Licht verschiedener Wellenlänge. Im sichtbaren Bereich reicht das Spektrum von kurzwelligem blauen Licht über Grün und Gelb hin zum langwelligen roten Licht. Unter normalen Bedingungen wird das kurzwellige Licht sehr viel stärker gestreut als das langwellige Licht. Das gelbe und rote Licht erreicht dann unser Auge, während das blaue Licht auf dem Weg dorthin zu großen Teilen abgelenkt wird. Die Rayleigh-Streuung macht also die Beobachtung einer blauen Sonne unwahrscheinlich.
Damit die Sonne blau erscheint, müssen die gelben und roten Komponenten des Sonnenlichts stärker unterdrückt werden als die blauen Komponenten. Bisher gab es mehrere mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Das Sonnenlicht könnte auf dem Weg zum Auge durch molekulare Bestandteile in der Atmosphäre wie Ozon und Wasser oder durch Aerosole absorbiert werden. Eine weitere Erklärung war die so genannte „anomale Streuung“ an Aerosolen.
Forschende haben für all diese Erklärungen nun genaue Modellrechnungen der Ausbreitung des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre durchgeführt. Dabei wurde beispielsweise der Einfluss der Rayleigh-Streuung, im Gegensatz zu vielen früheren Studien, genau modelliert. Mit Hilfe der Strahlungstransfersimulationen konnte ausgeschlossen werden, dass das Phänomen auftritt, weil Sonnenlicht durch molekulare Bestandteile und durch Aerosole absorbiert wird. Die Berechnungen zeigten dagegen, dass das Phänomen blaue Sonne aufgrund von „anomaler Streuung“ entsteht. Dabei wird das Licht der Sonne im sichtbaren Spektralbereich entgegen dem sonst üblichen Verhalten mit steigender Wellenlänge stärker gestreut. Das langwellige gelbe und rote Licht wird demnach stark gestreut, während das kurzwellige blaue Licht unser Auge erreicht. Diese Art der Streuung tritt nur auf, wenn alle Aerosolpartikel ungefähr die gleiche Größe und annähernd einen Radius von etwa 500 Nanometern haben. Und dies ist äußerst selten der Fall.
Weitere Informationen
DFG-Forschungsgruppe VolImpact (Volcanic impact on atmosphere and climate, FOR 2820)
Originalveröffentlichung
Wullenweber N., Lange A., Rozanov A., von Savigny C. (2021): „On the phenomenon of the blue sun“, in: Climate of the Past, 17, 969–983. Research highlight.
Ansprechpartner
Prof. Dr. Christian von Savigny
In Greifswald ist das Fahrrad das beliebteste Verkehrsmittel für den Arbeitsweg

Wie viel Pendelverkehr hat unsere Stadt täglich zu bewältigen? Welche Verkehrsmittel werden auf dem Weg zur Arbeit genutzt? Wie können wir unsere Mobilität nachhaltig gestalten? Welche Herausforderungen und Lösungen wird es in Zukunft geben? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Initiative „MobilitätsWerkStadt 2025“, an der sich die Stadt Greifswald als eine von deutschlandweit 50 Kommunen beteiligt hat. Hintergrund sind die seit Jahren steigenden Pendlerzahlen und ein daraus resultierendes erhöhtes Verkehrsaufkommen, insbesondere im Bereich des Pkw-Verkehrs. Dies beeinträchtigt die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt Greifswald zunehmend. Mit Hilfe eines forschungsbasierten Ansatzes zielt die „MobilitätsWerkStadt“ auf die Entwicklung und experimentelle Umsetzung von nachhaltigen Mobilitätskonzepten auf kommunaler Ebene. Die wissenschaftliche Begleitung der 15-monatigen Konzeptphase des „Modellprojektes Greifswald“ lag in den Händen von Professorin Dr. Christine Tamásy und von Dr. Oliver Klein am Lehrstuhl Humangeographie an der Universität Greifswald. Das Projekt wurde von den studentischen Hilfskräften Lukas Klische, Konrad Nemitz und Carry Ann Witthohn tatkräftig unterstützt.
Im Mittelpunkt stand eine umfangreiche Befragung von Greifswalder Arbeitnehmer*innen. Insgesamt 2455 Personen haben sich zwischen dem 6. August und dem 13. September 2020 an der Umfrage beteiligt. Wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich Arbeitsweg, Verkehrsmittelwahl, Parkverhalten, ÖPNV-Nutzung und so weiter konnten daraus erlangt werden. Auch wurden die Veränderungsbereitschaft bei der Wahl des Verkehrsmittels sowie mögliche Potenziale von nachhaltige(re)n Mobilitätskonzepten wie beispielsweise Park & Bike oder Car-/Bike-Sharing ausgelotet. Zwei Drittel der Befragten wohnen im Greifswalder Stadtgebiet, circa 13 Prozent im Stadt-Umland-Raum, vorwiegend in Gemeinden, die an Greifswald grenzen. Die übrigen 20 Prozent wohnen außerhalb des Stadt-Umland-Raums. Die Ergebnisse der Stichprobe zeigen unter anderem, dass das Fahrrad für den Arbeitsweg am häufigsten genutzt wird. 45 Prozent der Befragten fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Den Pkw nutzen 42 Prozent der Befragten. Insofern kann Greifswald nicht zu Unrecht als „Stadt der kurzen Wege“ oder „Fahrradstadt“ bezeichnet werden. 7 Prozent der Befragten können zu Fuß zur Arbeit gehen. Bahn und Bus spielen in Greifswald kaum eine Rolle. Nur 2 Prozent der Befragten nutzen die Bahn und 1,5 Prozent den Bus. Der häufigste Grund ist die ungünstige ÖPNV-Anbindung des Wohnortes. Hier liegen also noch Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, vor allem da ein nicht unerheblicher Teil der Befragten den ÖPNV grundsätzlich nutzen würde. Darüber hinaus gab es viel Zuspruch für innovative Konzepte, wie beispielsweise Park & Bike-Stationen, die vereinzelt schon in Planung sind, oder E-Bike- und Lastenrad-Sharing.
Neben der Befragung wurde eine umfangreiche Datenauswertung durchgeführt. Zentrale Grundlage waren die jährlichen Pendlerstatistiken der Bundesagentur für Arbeit. Danach werden täglich fast 13 000 Einpendler*innen und rund 6500 Auspendler*innen gezählt. Die meisten Einpendler*innen kommen aus der Hansestadt Stralsund (918 Personen), der Stadt Wolgast (514) sowie den Gemeinden Süderholz (510), Sundhagen (480), Neuenkirchen (478) und Weitenhagen (420). Die Daten zeigen jedoch, dass die Pendlerzahlen aus den Stadt-Umland-Gemeinden seit etwa zehn Jahren leicht rückläufig sind, während immer mehr Pendler*innen aus weiter entfernt liegenden Kommunen in Greifswald arbeiten. Das Einzugsgebiet des Greifswalder Arbeitsmarktes hat sich also vergrößert. Die verschiedenen Datensätze wurden mit Hilfe von ArcGIS kartografisch aufbereitet und visualisiert. Gemeinsam mit den Befragungsergebnissen liefern diese Analysen eine wichtige Grundlage für die zukünftige Mobilitätsplanung in Greifswald.
Zum Abschluss des Projektes fand am 25. März 2021 ein öffentliches Online-Symposium statt, wobei die Forschungsergebnisse sowie die weiteren Planungen der Stadt Greifswald vorgestellt und diskutiert wurden. Mit mehr als 70 zugeschalteten Gästen traf die Veranstaltung, die vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) moderiert und begleitet wurde, auf reges Interesse. Die Teilnahme an der „MobilitätsWerkStadt 2025“ und die dadurch initiierten Prozesse sind ein weiterer wichtiger Schritt, um das erklärte Ziel der Stadt Greifswald zu erreichen, den Pkw-Verkehr sowie die verkehrsbedingten Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Dafür ist es wichtig, den Umweltverbund weiter zu stärken, den ÖPNV attraktiver zu gestalten und den Zugang zur städtischen Mobilitätsinfrastruktur zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die bestehenden Stadt-Umland-Verflechtungen. Ein kontinuierlicher Dialog mit verschiedenen Stakeholdern sowie der Greifswalder Bevölkerung kann diese Aufgaben begleiten.
Informationen zum Stadtradeln
Noch bis zum 21 Mai 2021 können Kilometer beim Wettbewerb Stadtradeln gesammelt werden. Am 1. Juni geht es dann gleich mit der nächsten Herausforderung weiter, der ABC-Challenge. Während beim Stadtradeln verschiedene Kommunen gegeneinander antreten, radeln beim ABC-Radeln Hochschulen weltweit gegeneinander. Ziel beider Wettbewerbe ist, möglichst viele Kilometer per Rad zurückzulegen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und sich zu bewegen. www.uni-greifswald.de/radeln
Ansprechpartner Mobilitätsstudie
Dr. Oliver Klein
Wie Elias Lönnrot die Flöte neu erfand – Ein Fakt der Woche zum 30. Nordischen Klang 2021
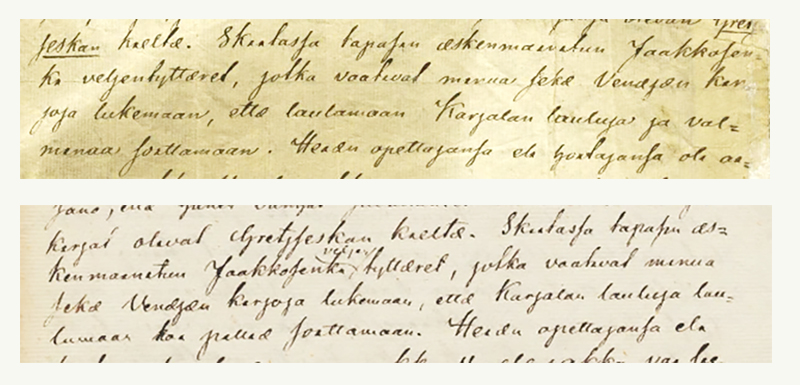
Die finnische Sprache erlebte im 19. Jahrhundert einen rasanten Aufschwung. Teils war dies Ausdruck des finnischen Nationalbewusstseins, teils aber auch eine schlichte Notwendigkeit: Es mussten finnische Bezeichnungen für viele kulturelle, technische und wissenschaftliche Begriffe und Gegenstände gefunden werden. Auch für das heute so renommierte finnische Musikleben wurden wichtige Grundlagen in dieser Zeit geschaffen, und entsprechend brauchte man eine finnische Musikterminologie. Benjamin Schweitzer, Doktorand am Institut für Fennistik und Skandinavistik, hat sich in seiner Masterarbeit mit einem sehr interessanten und lebendigen Bereich davon beschäftigt, nämlich den Bezeichnungen für die Instrumente des „klassischen“ Orchesters. Eines der wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit war, dass dieses Untergebiet viele Entwicklungen der finnischen Kultursprache quasi in Miniaturform abbildet. Dazu gehörten auch viele gescheiterte Versuche, neue Bezeichnungen zu prägen. Durch einen Textvergleich konnte Schweitzer z. B. auf den Tag genau nachweisen, wann Elias Lönnrots Vorschlag eines neuen Wortes für „Flöte“ entstand: In der Abbildung sieht man, wie im Entwurf (oben) eines Briefes an einen Freund noch das alte finnische pilli steht, in der Reinschrift (unten) seine Erfindung valmina. Obwohl Lönnrot ein begeisterter Flötenspieler und einflussreicher Sprachschöpfer war, wurde die Bezeichnung nie heimisch; die Flöte heißt auf Finnisch heute wie schon seit Jahrhunderten pilli oder huilu.
Passend zu diesem finnisch-musikalischen Forschungsthema hat Finnland in diesem Jahr die Schirmherrschaft des Nordischen Klangs inne. Im Sommer will das Festival, das eng mit dem Institut für Fennistik und Skandinavistik verbunden ist, wieder vor Ort in Greifswald unter freiem Himmel Musik aus Nordeuropa erlebbar machen. Mit Suistamon Sähkö und Antti Paalanen werden dann beispielsweise die irrwitzigsten und bahnbrechendsten Acts erwartet, die die finnische Folktronica zu bieten hat. Bevor es aber soweit ist, startet der 30. Nordische Klang im Mai erst einmal mit einem digitalen Festivalprogramm ins Jubiläumsjahr. Bis zum 22. Mai gibt es online eine bunte Auswahl aus Lesungen, Vorträgen, Musikbeiträgen und einem nordischen Spielfilm zu entdecken. Weitere Infos unter https://nordischerklang.de/programm-2021.
Ansprechpartner
Benjamin Schweitzer
Für eine Auseinandersetzung mit Verschwörungsmythen im Geschichtsunterricht

Sechs gute Gründe
Die Beschäftigung mit Verschwörungsglauben im Geschichtsunterricht, der sich den Paradigmen des Historischen Lernens verpflichtet fühlt, ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt gute Gründe, sich in der Ausbildung von angehenden Lehrer*innen mit Verschwörungstheorien aus geschichtswissenschaftlicher, didaktischer und methodischer Perspektive zu beschäftigen.
- Inhaltsorientierung: Abseits der Tatsache, dass es tatsächliche Verschwörungen in der Vergangenheit gab, entstehen Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit historischen Ereignissen. Die Französische Revolution oder die Entstehung der USA wird beispielsweise mit den Freimaurern in Verbindung gebracht. Der Angriff auf Pearl Harbour 1941 oder die Angriffe auf die Twin-Towers 2001 werden in Verschwörungskreisen als Machwerk der US-Regierung bezeichnet.
- Geschichtsbewusstsein: Verschwörungserzählungen sind wirkmächtige Fiktionen und Imaginationen, die das individuelle und das kollektive Geschichtsbewusstsein intensiv prägen können. Lernende sollen zwischen fiktionalem und reflektiertem Geschichts- und Politikbewusstsein unterscheiden lernen.
- Geschichtsbilder sind stabilisierte Gefüge von historischen Vorstellungen einzelner Personen oder ganzer Gruppen über die Vergangenheit. Sie lassen sich im Rahmen von Geschichtspolitik sehr gut und einfach instrumentalisieren. Verschwörungslegenden beinhalten oft problematische Geschichtsbilder und Welterklärungen, die im politischen Bereich verheerende Wirkung entfalten können. Die Nationalsozialisten sprachen von einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, im arabisch-islamischen Raum speist sich der weit verbreitete strukturelle Antisemitismus aus Elementen des Verschwörungsglaubens. Zentral ist hier bis heute die fiktionale Konstruktion der so genannten „Protokolle der Weißen von Zion“, die im Dunstkreis des russischen Geheimdienstes Ende des 19. Jahrhunderts auf nicht vollständig geklärte Art und Weise entstanden sind.
- Funktion von Geschichte: Geschichte ist Narration und Konstruktion. Sie dient der Orientierung, Identitäts- und Sinnbildung des Individuums oder der Gesellschaft respektive Teilen davon. Verschwörungserzählungen sind problematische, bisweilen auch gefährliche Bestandteile dieser Funktionen von Geschichte.
- Geschichtskultur: Heute begegnen Schüler*innen Geschichte außerhalb der Schule vor allem in Form von geschichtskulturellen Produkten. Die Begegnungen finden primär im Netz statt. Hier sind Verschwörungserzählungen auch ein bei Schüler*innen beliebtes Thema. Verschwörungserzählungen bedienen die imaginative, fiktionale, ästhetische, inszenierte, kontrafaktische und diskursive Verarbeitung von Geschichte. Diese Formen der Manipulation gilt es, im Historischen Lernen im Idealfall zu erkennen.
- Demokratiepolitische Dimension: Verschwörungserzählungen haben das Potential zur Demokratiegefährdung. Historische und politische Bildung leisten im schulischen Kontext einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur Festigung einer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Diese normative Vorgabe evoziert geradezu die Beschäftigung mit Verschwörungserzählungen im historisch-politisch bildenden Unterricht.
Ist ein Scheitern vorprogrammiert?
Eines der zentralen Ziele von Geschichtsunterricht ist die Dekonstruktion von fertigen Narrationen. Dieser Anspruch gelingt aber bereits abseits von Verschwörungserzählungen selten, da das Meinen, Annehmen und Glauben oftmals mächtiger ist, als der rationale Zugang zur Welt. Es ist daher im Rahmen des Historischen Lernens wenig verwunderlich, wenn es zur Ablehnung von Dekonstruktionsprozessen auch beim Thema „Verschwörungstheorien“ kommt. Der primäre Sozialisationsprozess von Schüler*innen ist sehr wirkmächtig, das zeigen beispielsweise die fiktiven und imaginierten Vorstellungen zur Religion. Die Resilienz gegenüber Strategien der Beweisführung und einem aufklärerischen Impetus sind vor allem bei denjenigen Lernenden zum Scheitern verurteilt, die bereits überzeugte Anhänger*innen von „Verschwörungstheorien“ sind.
Die digitale Welt verstärkt die Möglichkeiten, sich mit Irrationalitäten zu befassen und dies in der Form ständiger Verfügbarkeit, Abrufbarkeit und stets in aktualisierter Form. Es darf daher im Rahmen von schulischen Lehr-Lern-Settings nicht verwundern, wenn Schüler*innen mit Ablehnung darauf reagieren, „Verschwörungstheorien“ als solche zu erkennen und zu dekonstruieren. Schüler*innen gehen dann etwa in die innere Emigration und verweigern die Teilnahme am Unterricht. Andere suchen sich Verbündete im Unterrichtsgeschehen, um gegen die Versuche der Dekonstruktion mit Gegenbeweisen vorzugehen. Tatsächliche Verschwörungsgläubige unter den Schüler*innen werden noch mehr an ihre Überzeugungen glauben, nachdem sie mit überzeugenden Gegenbeweisen konfrontiert wurden. Ein Infrage stellen der Glaubwürdigkeit von Lehrenden kann als Strategie zur Anwendung kommen. „Woher wissen Sie denn das?“ kann Lehrende mehr als nur herausfordern. Dass Schüler*innen auf eine Erschütterung ihrer Identität ablehnend, mit Abwehr und irrational reagieren, liegt auf der Hand und sollte weder verwundern, noch davon abhalten, derartige Lehr-Lern-Settings immer wieder zum Einsatz zu bringen.
Für die Entwicklung von Lehr-Lern-Settings zu ausgewählten Beispielen von Verschwörungserzählungen sind daher folgende Grobziele stets zu berücksichtigen:
- Schüler*innen sollen Merkmale und Kategorien von Verschwörungserzählungen ermitteln können.
- Schüler*innen sollen die problematischen Aspekte von „Verschwörungstheorien“ nennen und erkennen können.
- Schüler*innen sollen jene Fähigkeiten erwerben, die es ihnen ermöglichen, selbst zwischen Verschwörungserzählungen und Nicht-Verschwörungstheorien zu unterscheiden.
- Schüler*innen sollen Funktion und Bedeutung von „Verschwörungstheorien“ beurteilen und bewerten können.
- Schüler*innen sollen die eigene Anfälligkeit für Verschwörungslegenden reflektieren lernen.
Im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung sind Studierende daher auf diese zweifelsohne herausfordernde Situation insofern vorzubereiten, dass sie sich der Schwierigkeiten und potentiellen Widerstände bewusst sind. Rezepte für diese Themen kann es natürlich nicht geben. Sie sollen aber ein Handlungsrepertoire kennen lernen, das sie in Hinblick auf die rechtliche, pädagogische und methodisch-didaktische Facette beim Unterricht von Verschwörungsglauben unterstützen soll. Das ist zumindest der Anspruch des Fachbereichs der Geschichtsdidaktik am Historischen Institut der Universität Greifswald.
Weitere Informationen
- Campus 1456 Magazin. Ausgabe 1/2021.
Ansprechpartner
Alfred Germ
Mit einer Röntgenquelle auf der Suche nach Arzneimitteln gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2
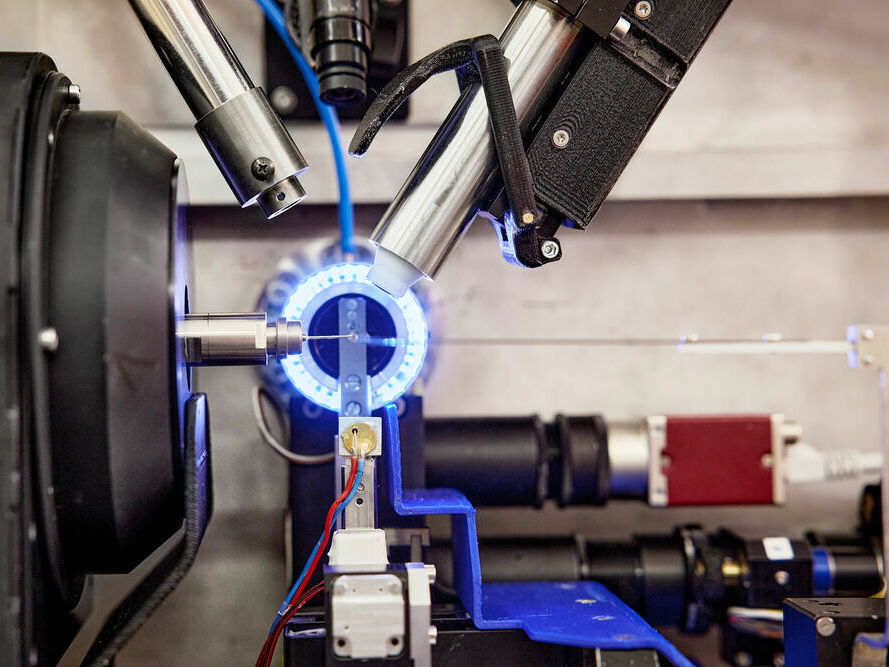
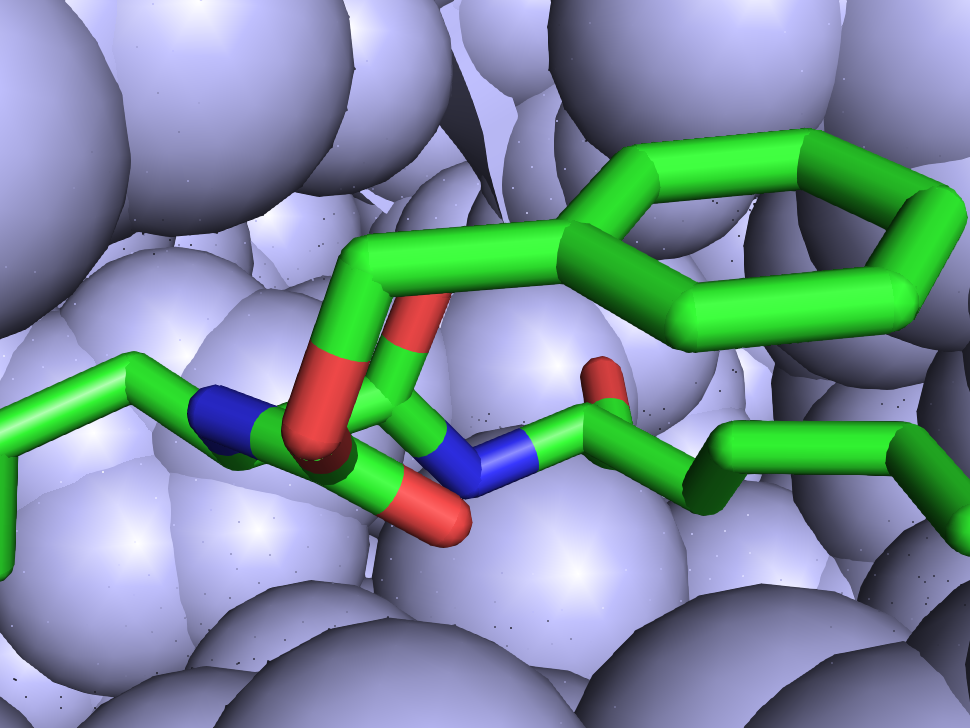
Auf die Corona-Pandemie hat die Forschung mit immensen Anstrengungen reagiert. In bisher unerwartet kurzer Zeit wurden Impfstoffe gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 entwickelt. Damit nicht oder unzureichend geimpfte Patient*innen besser vor den Folgen einer Infektion geschützt sind, braucht es Medikamente, die verhindern, dass der Virus sich im Körper ausbreitet. Die medikamentöse Behandlung von viralen Infektionen richtet sich gegen alle biochemischen Prozesse der Infektion und der Vermehrung des Virus im menschlichen Körper.
Wie vermehrt sich das Virus?
Nachdem das Virus in eine Körperzelle eingedrungen ist, zwingt es die Wirtszelle, lange Proteinketten herzustellen. Deren Aminosäuresequenz ist durch das Erbgut (Genom) der Corona-Viren festgelegt. Das Genom des Corona-Virus besteht aus einem RNA-Strang. Die lange Proteinkette enthält eine Hauptprotease (engl. main protease). Diese löst sich aus der Kette und zerlegt sie in viele kleine Proteine. Die einzelnen Proteine können weitere Virus-Partikel produzieren. Es werden immer mehr Kopien des Virus erzeugt.
Wirkstoffe gegen Viren sind außerordentlich schwierig zu finden
Für ein wirksames Medikament müssen chemische Verbindungen (Virostatika) gefunden werden, die an den Proteinen binden. Nur so kann die Vermehrung des Virus unterbrochen werden. Ein verlockendes Ziel für die Forschung ist die Hauptprotease.
In Hamburg haben die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christian Betzel am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Hamburg und die Arbeitsgruppe von Dr. Alke Meents am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY eine Zusammenarbeit initiiert und ein Forschungsprojekt organisiert, an dem fast 30 Institutionen beteiligt waren. Die Universität Greifswald war mit den ehemaligen Absolventinnen aus der Biochemie Julia Lieske (Diplom-Biochemie, 2007, jetzt DESY) und Nadine Werner (M.Sc. Biochemie, 2015, Universität Hamburg) indirekt beteiligt. Beide waren in der früheren Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Winfried Hinrichs, der seine Expertise in der Biokristallographie, Molekulare Strukturbiochemie und Enzymologie eingebracht hat. Die Ergebnisse der Studie wurden im April 2021 im Wissenschaftsmagazin Science online veröffentlicht. 102 Autor*innen waren an der Veröffentlichung beteiligt.
In der Studie wurden etwa 6000 bereits für die Behandlung anderer Krankheiten zugelassene Wirkstoffe mit Hilfe der Biokristallographie untersucht. Dazu wurden die Wirkstoffe in einem ersten Schritt zusammen mit der Hauptprotease kristallisiert. Mit Hilfe von Röntgendiffraktion wurden im Anschluss deren atomare Strukturen sichtbar gemacht. Dafür wurde die Röntgenlichtquelle PETRA III am DESY eingesetzt.
Mit dem Verfahren wurden 37 Wirkstoffe identifiziert, die an der Hauptprotease des SARS-CoV-2-Virus binden. Sieben dieser Stoffe wirkten antiviral und waren außerdem gut zellverträglich. Das ist eine unerwartet hohe Zahl. Zwei der Wirkstoffe eignen sich sogar für präklinische Untersuchungen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem anwendbaren Medikament, bei dem die molekulare Struktur dieser Wirkstoffe optimiert wird.
Weitere Informationen
Günther S., Reinke P. Y. A. et al. (2021): X-ray screening identifies active site and allosteric inhibitors of SARS-CoV-2 main protease, in: Science. DOI: 10.1126/science.abf7945
- Pressemitteilung und Erklärvideo des DESY zur Studie:
DESY-Röntgenquelle findet vielversprechende Kandidaten für Coronamedikamente
Ansprechpartner an der Universität Greifswald
Prof. Dr. Winfried Hinrichs
Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Milchproduktion unserer heimischen Kühe aus?

Wenn Futter verdaut und verstoffwechselt wird, entsteht Wärme im Körper. Diese Wärme muss über die Körperoberfläche wieder abgegeben werden. Dies geschieht entweder passiv oder unterstützt durch Schwitzen oder Hecheln. Kann nicht genug Wärme abgeführt werden, kommt es zur Hyperthermie. Die Körpertemperatur steigt an. Umgebungstemperaturen höher als 15 bis 20 Grad Celsius erschweren die Wärmeabgabe einer Kuh. Aufgrund des Klimawandels liegen die Sommertemperaturen immer deutlicher über diesem Wert. Temperaturen von über 30 Grad Celsius werden zudem immer häufiger gemessen. Unsere Milchkühe haben dann Schwierigkeiten, die Verdauungs- und Stoffwechselwärme an die Umgebung abzugeben. Um die Wärmebildung im Körper zu reduzieren, fressen sie weniger Futter. Dadurch geht die Milchleistung etwas zurück.
Die Tiere passen sich den hohen Umgebungstemperaturen an. Dies beginnt bereits im Mutterleib und setzt sich in den ersten Monaten nach der Geburt fort. Kälber, die im Sommer geboren werden, geben später weniger Milch. Leiden erwachsene Milchkühe unter akutem Hitzestress, wird unter anderem ihr Immunsystem aktiviert. Das kostet sehr viel Energie und kann den allgemeinen Gesundheitszustand der Tiere schwächen. Ziel sollte also sein, akuten Hitzestress bei unseren Tieren zu minimieren: Schattenplätze, eine ausreichende Frischluftzufuhr und Luftzirkulation sowie kalte Duschen können Abhilfe leisten.
Es ist wichtig, die Prozesse, die im Körper einer Milchkuh bei Hitze ablaufen, besser zu verstehen. Forschende der Universität Greifswald und des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie (FBN) haben die Ursachen für die Anpassungsvorgänge im Körper unserer Kühe genauer untersucht. Die Tiere wurden vier Tage bei 28 Grad Celsius in einer speziell dafür erbauten Klimakammer gehalten. Die Vergleichsgruppe wurde bei 15 Grad Celsius gehalten. Diese Gruppe erhielt die gleiche Futtermenge, die auch die hitzegestressten Kühe aufgenommen haben. Mit dem Versuchsdesign konnten die Forschenden unterscheiden, ob die Anpassungsvorgänge im Körper der Kühe auf die erhöhten Umgebungstemperaturen oder auf die damit einhergehende verringerte Futteraufnahme zurückzuführen sind.
Derzeit arbeiten die Forschenden an der Frage, wie Fütterung gestaltet sein muss, damit die Immunreaktion begrenzt wird und weniger Wärme im Körper entsteht.
Weitere Informationen
Eslamizad M., Albrecht D., Kuhla B. (2020): The effect of chronic, mild heat stress on metabolic changes of nutrition and adaptations in rumen papillae of lactating dairy cows, in: Journal of Dairy Science. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18417
Ansprechpartner
Dr. Dirk Albrecht
Die Wissower Klinken in 3D
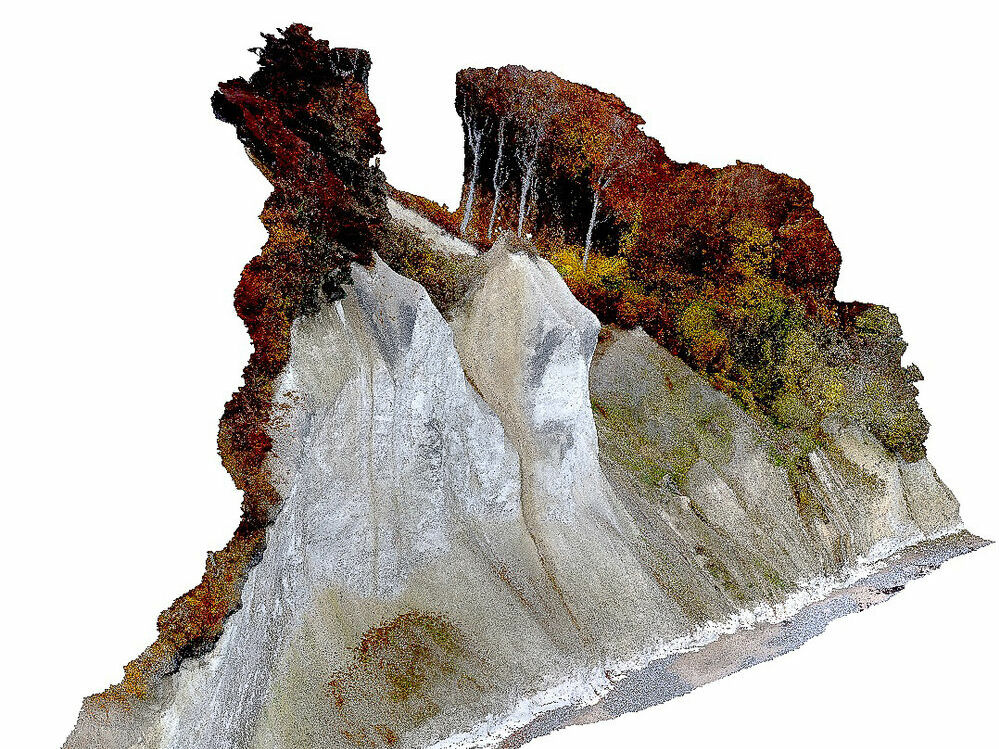
Die Wissower Klinken auf der Insel Rügen sind eines der bekanntesten Motive von Caspar David Friedrich und heute eines der beliebtesten Fotomotive bei Rügentouristen. Die Geologen der Universität Greifswald haben von diesen Kreidefelsen jetzt ein 3D-Modell erstellt und präsentieren es der Öffentlichkeit. Der Abschnitt der Wissower Klinken ist ein sogenannter Aufschluss. Solche Stellen sind für Geologen besonders interessant, da sie hier das Gestein direkt betrachten und untersuchen können, Strukturen sehen und Proben entnehmen können. An den Wissower Klinken lässt sich zudem beobachten, wie die Natur ständig an der Steilküste nagt. Vor über 15 Jahren brach ein großes Stück der damals noch viel höheren Wissower Klinken ab. Solche Küstenabbrüche sind an Steilküsten etwas völlig Normales. Die Drohnen erlauben es nun, Stellen mit sehr hoch aufgelösten Fotos zu dokumentieren, die man ohne die Drohne nur unter größten Schwierigkeiten und mit viel Klettererfahrung erreichen könnte. Werden solche Beobachtungen über mehrere Jahre hinweg wiederholt, ist man vielleicht in der Lage drohende Küstenabbrüche frühzeitig zu erkennen.
Das 3D-Modell wurde mithilfe von Drohnenüberflügen an der Kreideküste angefertigt. Die Steilküste wurde dabei aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und Höhen fotografiert. Markierungspunkte am Boden wurden mit einem stationären GPS-Gerät auf wenige Zentimeter genau eingemessen, um damit das 3D-Modell zu georeferenzieren. Das erlaubt das Modell in andere 3D-Plattformen wie beispielsweise Google Earth einzubinden. Aus den bei den Drohnenflügen gewonnenen hunderten von Bildern errechnet ein Programm ein 3D-Bild des Aufschlusses, das am Computer interaktiv von allen Seiten betrachtet werden kann. Die Drohnenaufnahmen haben Dr. Anna Gehrmann und Prof. Dr. Martin Meschede unter Mithilfe einiger studentischer Mitarbeiter*innen vom Institut für Geographie und Geologie vorgenommen. Die Ausarbeitung des 3D-Modells hat im Wesentlichen Anna Gehrmann durchgeführt.
Das dreidimensionale Modell ist Teil eines bundesweit angelegten Projektes unter der Schirmherrschaft der Deutschen Geologischen Gesellschaft – Geologische Vereinigung (DGGV). Die DGGV ist eine der ältesten deutschen Wissenschaftsvereinigungen, die anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums im Jahr 2023 das Projekt „30 Geotope³“ initiiert hat. Hier werden seit Februar 2021 jeden Monat Geotope und Aufschlüsse präsentiert, die mit Hilfe von Drohnen, 360°-Kameras, Laserscannern und differentiellem GPS dreidimensional aufgenommen wurden, um daraus 3D-Modelle zu erstellen. Mit ausführlichem Informationsmaterial ausgestattet werden diese Modelle dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Universität Greifswald ist an diesem Projekt beteiligt.
Die Serie startete mit dem Teufelstisch im Dahner Felsenland in der Pfalz, im März 2021 folgte der Dohlenstein bei Jena. Es soll mit diesen 3D-Darstellungen deutlich gemacht werden, dass Aufschlüsse die primären Informationsquellen in der Geologie sind und wie diese mit modernen Methoden dokumentiert werden können. Alle im Rahmen des Projektes aufgenommen Daten werden frei zugänglich zur Verfügung gestellt.
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt und sämtliche bisher erstellten 3D-Darstellungen mit weitergehenden Informationen zur Geologie und zur Herstellung der Modelle sind auf der Webseite www.digitalgeology.de zu finden. In der Galerie werden die 3D-Modelle abgelegt und jeden Monat wird mindestens eines dazukommen.
Für weitere Informationen stehen Dr. Anna Gehrmann und Prof. Dr. Martin Meschede (derzeit Vizepräsident der DGGV) vom Lehrstuhl für Regionale Geologie | Strukturgeologie der Universität Greifswald zur Verfügung.
Wo die richtigen Fragen Leben retten können: Notfallkommunikation auf Polnisch
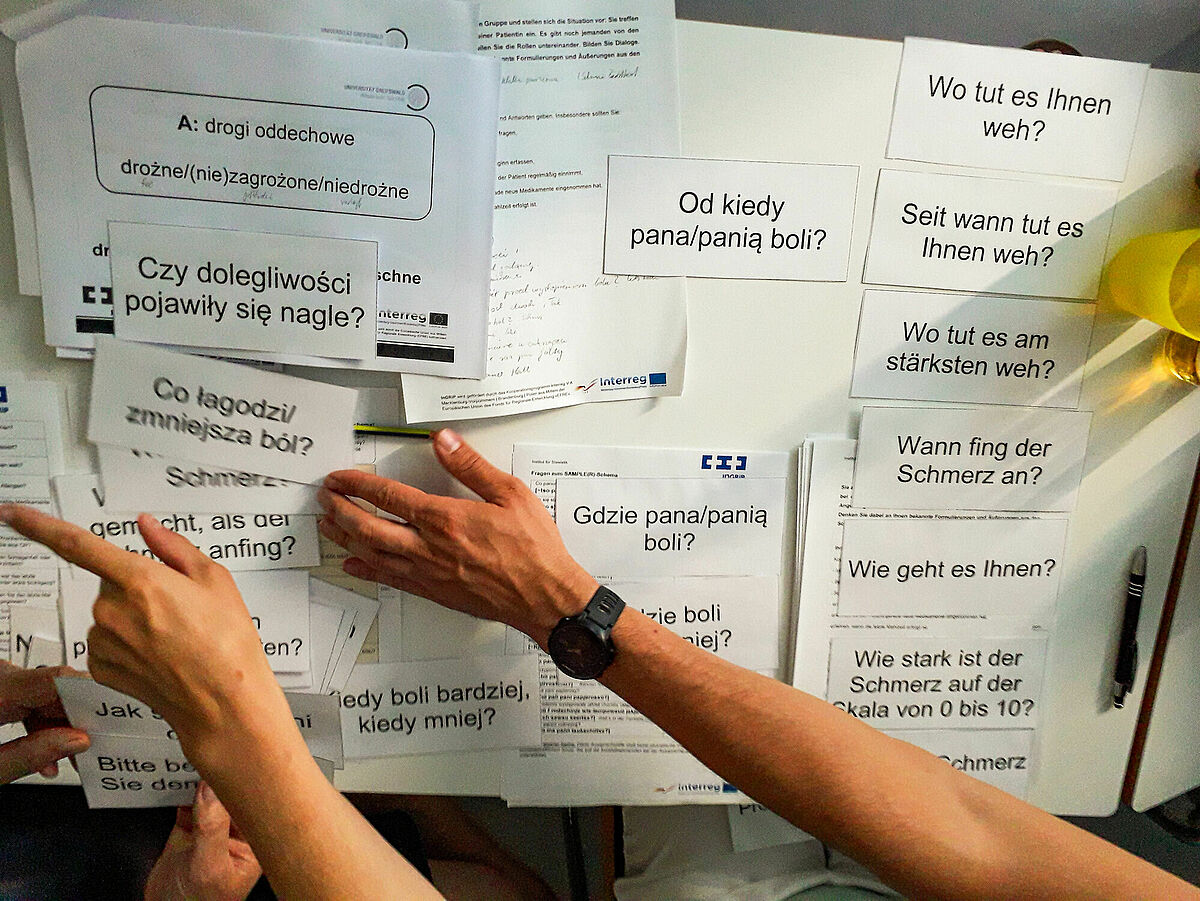
Wer in ein Notfallsituationen Leben retten will, der muss die richtigen Fragen stellen können. Rettungskräfte in unserer Region können auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze tätig sein. Sie müssen die richtigen Fragen also auch auf Polnisch stellen und darauf angemessen reagieren können. Welche sprachlichen Hilfsmittel benötigen Rettungskräfte? Wie müssen Sprachtrainings aussehen, damit Rettungskräfte im Notfallsituationen Leben retten können? Antworten darauf haben Forschende der Universität und Universitätsmedizin Greifswald gemeinsam mit verschiedenen Rettungsdiensten im Rahmen des jetzt abgeschlossenen interdisziplinären grenzüberschreitenden Projekts InGRiP (2017–2021) gesucht und gefunden.
InGRiP ist das Kürzel für „Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg“. Ziel des Pilotprojekts war, die Zusammenarbeit der zuständigen Institutionen im grenzüberschreitenden Rettungsdienst zu stärken und zu verbessern. Dabei waren gezielte Sprachtrainings für Rettungskräfte der Region ein wesentlicher Baustein. Das am Institut für Slawistik entwickelte Trainingskonzept wurde mit polnischen und deutschen Rettungskräften erprobt und wissenschaftlich begleitet. Die Rettungskräfte wurden sprachlich von Mitarbeiter*innen der Slawistik während Präsenzveranstaltungen sowie E-Learning-Phasen vorbereitet. Deutsche und polnische Rettungskräfte lernten zuerst separat die jeweilige Nachbarsprache, um dann gemeinsam in einem notfallmedizinischen Simulationstraining zu üben. Die Forschenden konnten somit in praxisnahen Situationen beobachten, wie die Notfallkommunikation realisiert wird.
Die notfallmedizinische Kommunikation wurde wissenschaftlich erfasst und ausgewertet. Sie führte den Projektbeteiligten erneut vor Augen, wie wichtig Polnisch als Nachbarsprache in einer Notfallsituation sein kann. Die Analyse hat verschiedene sprachliche Merkmale deutlich gemacht. So lassen sich die erfassten Äußerungen in verschiedene Sprechakte gruppieren: Assertiva, Direktiva und Expressiva.
Expressiva werden im Gespräch vor allem von Patient*innen geäußert. Diese sind unterrichtsrelevant, da die Fremdsprachenlernenden die Antworten der Patient*innen auf Polnisch verstehen und darauf angemessen reagieren sollten. Dies muss auch möglich sein, wenn Patient*innen ihren Aussagen eine emotionale Komponente hinzufügen. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Antworten der Patient*innen mehrheitlich verstanden werden, jedoch die Reaktion nicht immer angemessen ist.
Die Untersuchung zeigte auch, dass die von Rettungskräften gestellten Fragen eine besondere Rolle spielen. Fragen gehören meist zur Gruppe der Direktiva. Es gibt unterschiedliche Fragetypen wie
- Informationsfragen: Co teraz panu / pani dolega? – Was fehlt Ihnen jetzt?
- Einschätzungsfragen: Na skali od 0 do 10, jak silny to ból? – Auf der Skala von 0 bis 10, wie stark ist der Schmerz?
- Verhaltensfragen: Brał(a) pan(i) dziś już leki? – Haben Sie heute schon ihre Medikamente eingenommen?
- Kettenfragen: Dlaczego i kiedy był(a) pan(i) ostatni raz w szpitalu? – Wann waren Sie das letzte Mal im Krankenhaus und warum?
Sie alle sind für Notfallsituationen relevant. Ebenso relevant ist das Erlernen der Fragesequenzen, die in notfallmedizinischen Schemata wie SAMPLER und OPQRST vorkommen. Dies sind festgelegte Fragemuster, die in Notfallsituationen genutzt werden, um das Krankheitsbild zu spezifizieren und eine erste Diagnose erstellen.
Weitere Informationen
Projekt InGRiP
Literatur:
- Lisek, Grzegorz (2020): Notfallmedizinische Kommunikation im Unterricht Polnisch als Fremdsprache. Analyse von Gesprächsverhalten deutschsprachiger Rettungskräfte. In: Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. XLVII/2 (2020), S. 169-193.
- Lisek, Grzegorz (2019): Fachkommunikation und regionale Vernetzung am Beispiel des Projekts Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg (InGRiP). In: Greifswalder Beiträge zur Hochschullehre. Perspektiven der Lehre im 21. Jahrhundert. Ausgabe (10) 2019, S. 21-32.
Ansprechpartner
Dr. Grzegorz Lisek
Soziale Kognition im Alter

Soziale Kognition erlaubt es, die Gefühle, Perspektiven und Gedanken anderer Menschen zu verstehen. Mit Hilfe dieser Fähigkeiten können wir geistige Prozesse anderer Personen interpretieren, erklären und manchmal sogar deren Verhalten vorhersagen. Soziale Kognition ist daher ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher menschlicher Interaktionen – sei es beim Plaudern mit Freunden, beim Austausch mit der Kollegin oder auf einer Familienfeier.
Allerdings kommt es im Laufe des Lebens – als Teil des normalen Alterns – oft zu einer Verschlechterung dieser Fähigkeiten. Des Weiteren ist bekannt, dass verschiedene Alterserkrankungen, wie bestimmte Formen von Demenz, zu stark ausgeprägten sozio-kognitiven Einschränkungen führen. Dies kann dazu führen, dass die Gefühle anderer Menschen nur schwer erkannt werden. Weiter sind Probleme möglich, verschiedene Perspektiven nachzuvollziehen, wenn eine Geschichte erzählt wird. Um dem vorzubeugen ist es wichtig, kognitiv und sozial aktiv zu bleiben. Beispielsweise hilft es, Hobbys innerhalb einer Gruppe auszuüben, oder in einem aktiven sozialen Netzwerk aus Freund*innen und Bekannten aktiv zu sein, in dem ein regelmäßiger Austausch stattfindet.
Seit Anfang 2020 gehören sozial-kognitive Fähigkeiten zu den Forschungsschwerpunkten der Arbeitsgruppe „Gesundes Altern und Prävention dementieller Erkrankungen“ an der Universitätsmedizin Greifswald. Forschende untersuchen nicht nur die Folgen einer verminderten sozialen Kognition. Sie erkunden auch Möglichkeiten, dieser Verschlechterung vorzubeugen. Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Marcus Meinzer untersucht mit einer Reihe von neurowissenschaftlichen Methoden gezielt,
- welche Bereiche sozialer Kognition im gesunden Altersprozess und bei verschiedenen Alterserkrankungen besonders stark betroffen sind,
- was diesen Veränderungen zugrunde liegt und
- ob sich betroffene Funktionen durch Intervention verbessern lassen.
In Hinblick auf unsere älter werdende Gesellschaft wird es immer wichtiger, Wege zu finden, wie wir sozio-kognitive Fähigkeiten möglichst lange erhalten können, um älteren Menschen eine lange und aktive Teilnahme am sozialen Leben zu ermöglichen. Dazu möchte das Meinzer Lab mit seiner Forschung einen Beitrag leisten.
Ansprechpartner*innen
Prof. Marcus Meinzer
Dr. Mandy Roheger
Die heimlichen Klimahelden – Bodenbakterien binden Methan aus der Atmosphäre und schützen so das Klima

Methan ist als Treibhausgas etwa 25-mal wirksamer als Kohlendioxid und damit bedeutend für die Entwicklung des Klimas. Die Konzentration von Methan in der Atmosphäre hat seit Beginn des Industriezeitalters um 150 Prozent zugenommen. Mehr als ein Drittel der globalen Emissionen des Klimagases stammt aus sauerstoffarmen Böden. Gut durchlüftete, sauerstoffreiche Böden sind dagegen eine wichtige Senke für Methan. In diesen Böden fühlen sich methanotrophe Bakterien wohl. Sie nutzen Methan für ihre Energiegewinnung – fressen quasi das Klimagas. So wird das Gas aus der Atmosphäre entfernt und im Boden gebunden.
Eine intensive Bewirtschaftung von Grünland und Wäldern kann die Aktivität dieser Bakterien hemmen, wodurch weniger Methan von den Bodenbakterien oxidiert wird. Welchen Einfluss haben Intensität und Art der landwirtschaftlichen Nutzung von Grünland- und Waldböden auf die Anzahl und Vielfalt von methanfressenden Bakterien in Böden? Wie wirkt sich dies auf die Methanoxidationskapazität von Boden aus?
Dies haben Forschende der Universitäten Greifswald und Hohenheim sowie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg anhand von rund 300 verschiedenen Wald- und Grünlandböden aus verschiedenen Regionen Deutschlands untersucht. Sie fanden heraus: Wälder sind eine wichtige und stabile Senke für Methan. Unterschiedliche physikalisch-chemische Bodenbedingungen und die Art der Waldbewirtschaftung wirken sich kaum auf die Methansenkenfunktion von Waldböden aus. Die Fähigkeit von Grünlandböden, Methan aus der Atmosphäre zu entfernen, hängt deutlich stärker von standortspezifischen Bodeneigenschaften ab. Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung von Grünlandböden wirkt sich in fast allen untersuchten Böden negativ auf die Methansenkenkapazität der Böden aus, und besonders schädlich ist Düngung.
Wichtig für die Aktivität der methanfressenden Bakterien in Wäldern und Grünland ist auch die Lagerungsdichte des Bodens. Je kompakter ein Boden ist, desto schlechter funktioniert der Luftaustausch zwischen Atmosphäre und Boden. Den Bakterien fehlt dann auch Methan. Ihr Stoffwechsel wird heruntergefahren. Dies mindert Aktivität und Anzahl der Bakterien. So wird weniger Methan aus der Atmosphäre im Boden gebunden.
Eine weniger intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie Aufforstung kann die Senkenfunktion der untersuchten Wald- und Grünlandböden erhöhen und das Klima schützen.
Weitere Informationen
Medieninformation „Methanfressende Bakterien in Böden – heimliche Helden im Kampf gegen den Klimawandel“
Ansprechpartner
Prof. Dr. Tim Urich
Das Grabinventar des Herzogsgrabes von Alt Reddevitz auf Rügen


Die Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer der Universität Greifswald lässt tief in die Vergangenheit blicken. Sie wurde 1823 gegründet und bildet heute mit ihren mehr als 50 000 Funden die gesamte pommersche Geschichte ab – von der Steinzeit bis zur Neuzeit.
Darüber hinaus beinhaltet sie die Sammlungen und Nachlässe bedeutender pommerscher Forscher wie zum Beispiel des ehemaligen Rektors der Universität, Prof. P.F. Kanngießer (1774–1833), und des ehemaligen Vorsitzenden der Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Hugo Lemcke (1835–1925). Dank ihnen finden sich von verschiedenen Forschungsreisen auch Bronzefunde aus Italien sowie Keramik aus Mesopotamien unter den Sammlungsbeständen.
Ein herausragender Fundkomplex im Sammlungsbestand ist das Grabinventar des sogenannten Herzogsgrabes von Alt Reddevitz auf Rügen. Diese jungsteinzeitliche Megalithanlage wurde 1922–1924 sowie 1960 ausgegraben, wobei zahlreiche menschliche Skelettreste, aber auch Keramik, Feuersteinbeile, Pfeilspitzen und bearbeiteter Bernstein, beispielsweise in der Form von Doppeläxten, zutage traten.
Die Sammlung ist bis heute für die Wissenschaft und Forschung von Bedeutung. Das zeigen zahlreiche Forschungs- und Leihanfragen aus dem In- und Ausland. Zum Beispiel lässt sich anhand ihrer Funde die Entwicklung des Metallhandwerks nachvollziehen, da hier Schwerter und Beile der Bronzezeit zu finden sind, ebenso wie fein gearbeiteter Schmuck der Eisenzeit, arabische Münzen der frühmittelalterlichen Seehandelsplätze, slawische Schläfenringe und mittelalterliche Steigbügel mit Reitersporen. Zudem bieten die zahlreichen Sammlungsfunde der umfangreichen Altstadtgrabungen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts einen detailreichen Einblick in das mittelalterliche und neuzeitliche Stadtleben Greifswalds.
Ein Teil der Sammlungsfunde ist heute für die Öffentlichkeit zugänglich und kann unter anderem in der Dauerausstellung des Pommerschen Landesmuseums betrachtet werden.
Ansprechpartnerin
Anne Dombrowsky
Könnte es Sepsis sein?
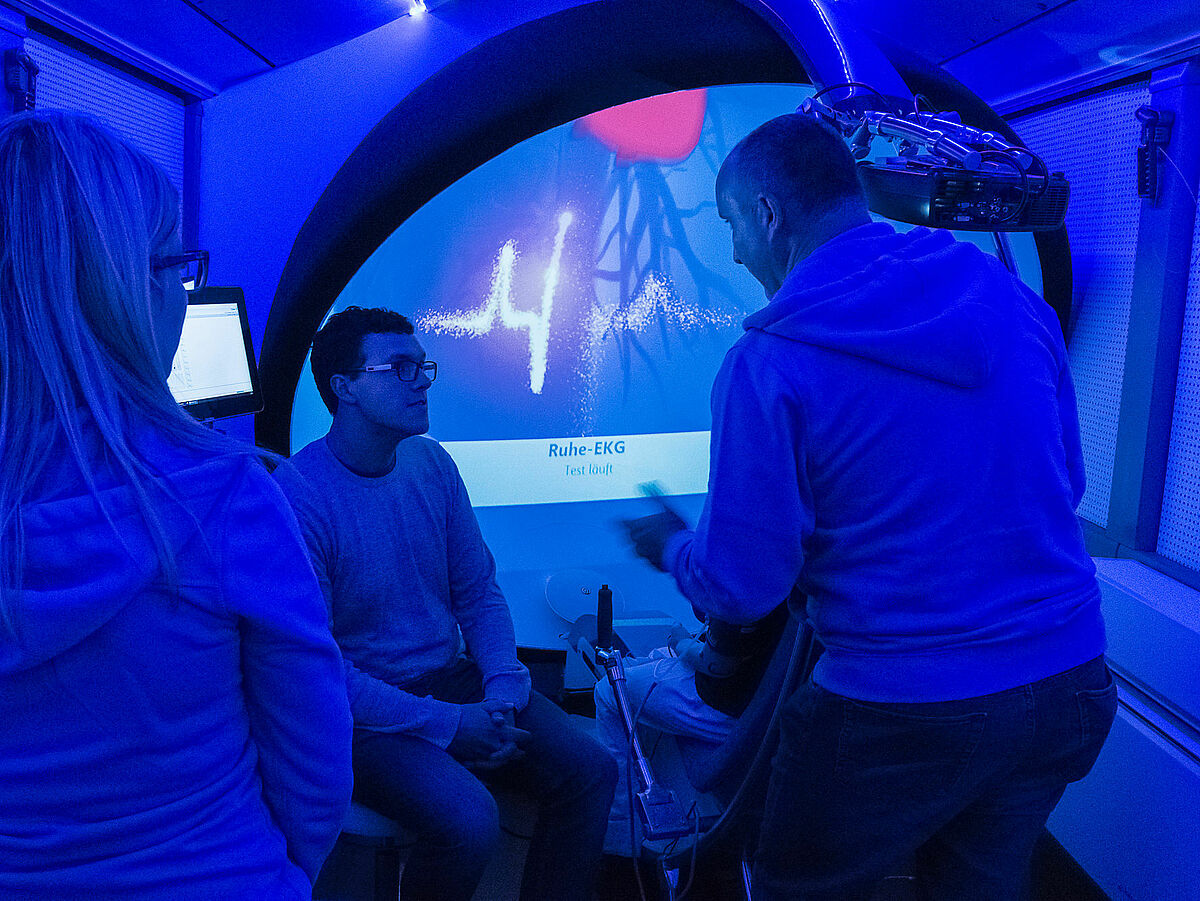
Sepsis, vielen wahrscheinlich eher als Blutvergiftung bekannt, ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Alle sieben Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an einer Sepsis. Häufig werden die Symptome zu spät erkannt und behandelt. Doch was macht die Erkrankung so gefährlich? Und wie kann die Behandlung verbessert werden?
Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Dabei schädigt die körpereigene Abwehrreaktion gegen die Infektion das eigene Gewebe und die eigenen Organe. Die Erkrankung ist lebensbedrohlich und immer ein Notfall, der im Krankenhaus behandelt werden muss. Aufgrund der hohen Gefahr von Organversagen findet die Behandlung fast immer auf der Intensivstation statt.
Eine weit verbreitete Falschinformation ist, dass Blutvergiftungen vor allem nach einer Infektion mit multiresistenten Erregern im Krankenhaus auftreten. Doch in den meisten Fällen wurde die Infektion außerhalb des Krankenhauses verursacht. Prinzipiell kann Sepsis jeden treffen. Manche Gruppen wie chronisch Kranke, Neugeborene oder Menschen über 60 Jahren haben ein erhöhtes Risiko. Das Problem bei Sepsis ist, dass die Symptome anfangs oft sehr unspezifisch sind und das Wissen über die Gefahr einer Blutvergiftung in weiten Teilen der Bevölkerung nicht bekannt ist. Sie erkennen deshalb die Frühwarnzeichen nicht.
Doch auch das medizinische Fachpersonal ist häufig nicht gut genug darauf geschult, eine Sepsis zu erkennen. Patient*innen berichten, dass die Erkrankung oft zu spät erkannt wurde und dass die Diagnostik und Therapie nur mit Verzögerung begonnen wurden. Dabei ist es bei einer Sepsis sehr wichtig, dass die Diagnostik schnell beginnt und auch die Therapie parallel einsetzt. Dazu müssen unter anderem Blutkulturen angelegt werden, um den Erreger nachzuweisen.
Damit Fälle von Sepsis in Zukunft besser und schneller erkannt werden können, ist eine gemeinsame Strategie von Bundesregierung, Kostenträgern, Leistungserbringern und Selbstverwaltung nötig. Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, der Deutschen Sepsis Hilfe und der Sepsis Stiftung hat der Sepsisdialog der Universitätsmedizin Greifswald am 16. Februar 2021 die Kampagne #DeutschlandErkenntSepsis gestartet. Dabei soll sowohl die Bevölkerung aufgeklärt und informiert als auch das medizinische Personal besser ausgebildet werden. Der Film „Sepsis. Gönn‘ dem Tod ‘ne Pause“ wurde zum gemeinsamen Start präsentiert.
Für praktizierende Ärzt*innen ist es wichtig, die unspezifischen Symptome einer Blutvergiftung möglichst früh zu erkennen, sodass sie die Ursachen der Erkrankung behandeln können. Studien zeigen, dass ein Screening bestimmter Vitalwerte dabei helfen kann, eine Sepsis zu diagnostizieren. Da nicht sicher ist, welche Parameter am besten untersucht werden sollten, ist die Empfehlung aus der Praxis, dass jede*r kritische Patient*in mit mindestens zwei der typischen Symptome als potenzielle*r Sepsis-Patient*in gelten solle. Die Kriterien sind unter anderem Fieber über 38 Grad, Bewusstseinsstörung, schneller Puls und Kurzatmigkeit. In der Therapie wird dann die Infektion möglichst schnell behandelt und der Entzündungsherd entfernt oder saniert.
Das Qualitätsmanagement-Projekt „Sepsisdialog“ der Universitätsmedizin Greifswald hat die Krankenhaussterblichkeit aufgrund von Sepsis in den letzten Jahren erheblich gesenkt. Ein „Change Management Team“ bestehend aus Ärzt*innen und Pflegekräften bietet Weiterbildungen und Schulungen an. Zusätzlich informiert die Website www.sepsisdialog.de Patient*innen und medizinisches Personal. 2017 wurde der „Sepsisdialog“ mit dem „Global Sepsis Award“ der Global Sepsis Alliance ausgezeichnet. Seit dem Sommer 2020 gibt es außerdem die SepsisAkademie mit monatlichen Online-Schulungen.
Weitere Informationen
Ansprechpartner
PD Dr. Matthias Gründling
Das Herrenhauszentrum Greifswald erforscht die Geschichte der Herren- und Gutshäuser des Ostseeraums und macht sie digital erlebbar

Herrenhäuser und auch Gutshäuser finden sich bis heute in den Ländern des Ostseeraums und darüber hinaus. Die Gebäude der meist landadligen Besitzer sollten durch ihre Bauform und ihre landschaftliche Verortung den Bauherrn in der Region sichtbar machen und zugleich als Teil der Region darin verwurzeln. Die Häuser waren häufig schon von weitem erkennbar und das Wegenetz in der näheren Umgebung war auf das Haupthaus als zentralen Fixpunkt ausgerichtet. Im Inneren vermittelten fest in der Wand verbaute Dekorationen, Sammlungen, kostbare Möbel oder Porzellan aus Fernost dem Besucher sofort den Rang des Bewohners und sorgten somit wortlos für ein standesgemäßes Miteinander.
Leider sind viele dieser Gebäude im gesamten Ostseeraum nicht mehr vorhanden oder nur noch als Ruinen wahrnehmbar. Schnell fällt auf, dass diese Häuser nur in ihrer Gesamtheit, das Gefühl vermitteln konnten, für welches sie erbaut wurden. Auch eine 3D-Rekonstruktion wie für das Herrenhaus Friedrichstein im heutigen Oblast Kaliningrad erzeugt nur ansatzweise das Gefühl jenes Zusammenspiels von Innen und Außen.
Das Herrenhauszentrum Greifswald, welches zum 1. Juni oder 1. Juli 2021 starten soll, wird sich dieser Thematik annehmen. Im dreijährigen Pilotprojekt wird ein Team aus Postdoktorand*innen und weiteren Fachleuten sowie sechs Doktorand*innen die Herrenhauslandschaft des Ostseeraums anhand ausgewählter Beispiele erforschen. Dabei liegt der Fokus auf den Jahren zwischen 1710 und 1770. Von Beginn an soll die Gesamtheit der Anlagen im Blick bleiben.
Es geht nicht darum, sämtliche Details zu rekonstruieren und bis in die letzte Furche zu ergründen, aber darum die politischen, sozialen, wirtschaftlichen Perspektiven neben den kunstwissenschaftlichen und historischen Kernbereichen zu bestimmen und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Zudem werden mit neuester Technik und digitaler Unterstützung noch vorhandene Fragmente und Anlagen dokumentiert und digitalisiert, ausgewählte Objekte beziehungsweise Fragmente virtuell rekonstruiert, mittels Bodenradar Verstecktes aufgespürt und kartiert und alles auf einer später frei zugänglichen Plattform aufbereitet, zusammengefügt und präsentiert.
Ansprechpartner
Prof. Dr. Kilian Heck
Torsten Veit
Das 3D Modell von Schloss Friedrichstein und dieses Video entstanden im Rahmen des Projekts „Virtuelle Rekonstruktionen in transnationalen Forschungsumgebungen – Das Portal: Schlösser und Parkanlagen im ehemaligen Ostpreußen“ (2013–2016 ) des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung. Die Kunstgeschichte unserer Universität war Kooperationspartner in diesem Projekt.
Bitte beachten Sie: Sobald Sie sich das Video ansehen, werden Informationen darüber an Youtube/Google übermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Google Privacy.
Vom Brautbett in die Ewigkeit – Flurnamenforschung in Vorpommern

Flurnamen oder im Fachausdruck Mikrotoponyme sind Namen, mit denen landwirtschaftlich genutzte Flächen aller Art bezeichnet werden oder wurden. In erster Linie sind die Namen von Äckern, Wiesen, Weiden und Waldflächen gemeint. Oft sind diese heute schon in Vergessenheit geraten. Früher wurde damit die sprachliche Orientierung in einer noch weitgehend agrarisch geprägten Lebens- und Arbeitswelt gewährleistet. Die Fülle der vorhandenen Benennungsmotive ist nahezu unerschöpflich, weswegen auch ungewöhnliche Namen wie das Brautbett (ein Teich in Sestelin bei Greifswald) und die Ewigkeit (eine abseits liegende Parzelle auf der Insel Hiddensee) belegt sind. Deutlich profaner und wesentlich typischer für die heimische Flurnamengebung sind dagegen Flurnamen, die Hinweise auf Flora und Fauna geben. So verweist etwa die Eller Kuhl auf eine ehemals mit Erlen bestandene Senke, während der Kronskamp seinen Namen dort rastenden Kranichen verdankt.
Das Digitale vorpommersche Flurnamenbuch dokumentiert und analysiert die historisch überlieferten Flurnamen einer Region, die sprachgeschichtlich besonders durch das Nebeneinander von niederdeutschen und älteren slawischen Namenschichten geprägt ist. Im Herbst 2020 wurde die digitale Datenbank freigeschaltet. Damit werden der interessierten Öffentlichkeit die Ergebnisse eines namenkundlichen Forschungsprojekts präsentiert, das von 2016 bis 2020 am Institut für Deutsche Philologie durchgeführt wurde. Insgesamt konnten durch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt aus unterschiedlichen Quellengattungen rund 40 000 Flurnamen erhoben werden, von denen der weitaus größte Teil bereits in die Datenbank eingepflegt worden ist.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Datenbank sowohl für den fachwissenschaftlichen als auch für den eher heimatkundlich orientierten Zugriff zahlreiche Möglichkeiten bietet, das gesammelte Namenmaterial auf spezifische Fragen hin zu untersuchen. So sind selbstverständlich die Flurnamen aller Ortspunkte schnell und übersichtlich zu ermitteln. Interessierte können aber auch nach Grund- und Bestimmungswörtern suchen, etwas über die Beteiligung von Adjektiven und Präpositionen in Erfahrung bringen, unterschiedliche formale Bildungsweisen in den Blick nehmen, enzyklopädische Informationen abfragen, zeitliche Eingrenzungen vornehmen, slawische Namen zusammenstellen und vieles andere mehr.
Der Flurnamenforschung kommt in wissenschaftlicher Hinsicht eine Brückenfunktion zu, weil mit ihr interdisziplinäre Aspekte angesprochen sind. Mikrotoponyme besitzen nämlich nicht nur Relevanz für die Sprachwissenschaft, sie vermitteln zudem auch wertvolle Informationen besonders für die Geschichtswissenschaft, die Volkskunde und die Geografie.
Ansprechpartner
PD Dr. Matthias Vollmer
Wie vielstimmig ist unsere Geschichte? Über den Umgang mit Geschichte und Erinnerungen in der Musik unserer heutigen pluralen Gesellschaften

Welche unterschiedlichen Geschichtskonzeptionen und Historiographien bestimmen das Zusammenleben in heutigen pluralen Gesellschaften mit? – Diese Frage war in den vergangenen Monaten Thema einer engagiert geführten öffentlichen Diskussion. Sie fordert dabei nicht nur zu einer Reflexion über gesellschaftsrelevante Deutungshoheiten oder adäquate Geschichts- und Erinnerungsbegriffe heraus, sondern lenkt auch den Blick auf die vielfältigen Verbindungen unterschiedlicher „Geschichten“ im lokalen Zusammenleben. Diese Verbindungen stehen seit einigen Jahrzehnten nicht zuletzt im Fokus zeitgenössischer musikalischer Produktionen, die ein breites Spektrum von der Interpretation klassischer Musik über HipHop und Rap bis hin zu Weltmusikfestivals, Chanson und Alter Musik abdecken und die im Februar 2020 in einem gemeinsamen, vom DAAD geförderten Tagungsprojekt des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Universität Greifswald und des Département de Musicologie der Universität Tours in Frankreich untersucht wurden.
„Geschichte“ nimmt in zeitgenössischen Musikproduktionen ganz verschiedene Bedeutungen an, die mit unterschiedlichen Funktionen und Wirkungen verbunden sind: Da gibt es Bezüge auf politik-, sozial- und kulturhistorische Ereignisse und Zusammenhänge wie den Nationalsozialismus, den Holocaust, die Französische Revolution, den Algerienkrieg oder den Mauerfall durch Musiker*innen und Komponist*innen mit Migrationserfahrungen. Auch historische Metaphern und Bilder für Interkulturalität und Mobilität wie die Seidenstraße, der Orientexpress oder der Koffer werden oft in Rapsongs, Kompositionen zeitgenössischer Kunstmusik oder Liedern angewandt. Sie alle garantieren einerseits eine Erweiterung des Rezipient*innenkreises über einzelne Minderheiten hinaus im französischen Rap, andererseits aber auch Kombinationen zeitlich heterogener Ästhetiken wie beispielsweise des mittelalterlichen Sonetts mit surrealistischen Zügen in Liedern italienischer cantautori wie Vinicio Capossela oder der Musikdramen Richard Wagners mit der Peking-Oper bei der usbekischen, in Berlin lebenden, Komponistin Aziza Sadikova. Zudem spielt die Arbeit an der Aufarbeitung historischer Zusammenhänge und ihrer Vermittlung in aktuellen Musikprojekten eine wichtige Rolle, durch die Archivmaterial, Zeitzeugenberichte oder geschichtswissenschaftliche Konzepte wie Kulturtransfer in Musik und Musikrezeption verankert werden. Nicht zuletzt rücken „Geschichten“ als Narrationen migrantischer oder transkultureller Biographien in den Vordergrund, durch die Geschichtskonstruktionen hinterfragt oder wie im Fall des weltweit aktiven türkischen Pianisten und Komponisten Fazıl Say politische Äußerungen musikkulturell übergreifend gebunden werden. Im Umgang mit Geschichte/n im gegenwärtigen Musikleben werden somit auch Zeichen einer Neuorientierung nach der fragmentierenden und theatralischen Kunst der Postmoderne sichtbar.
Weitere Informationen
- Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft an der Universität Greifswald
- Département de Musicologie der Universität Tours in Frankreich
- Literatur:
Bachir-Loopuyt T., Zur Nieden G. (Hg., 2020): „Musik Geschichte Pluralität,“ in: Die Tonkunst, Heft 4. - Video:
Fazil Say, Memleketim (Mein Heimatland, Text von Nâzim Hikmet), zu dem auf der Tagung eine französische Fassung von Gülay Hacer Toruk und Andreas Krause erarbeitet und erstmals aufgeführt wurde.
Les Femmes connaîssent la chanson – Recital lecture auf der Tagung «Musiques mémoires histoire dans des sociétés plurielles», Tours 13. Februar 2020, organisiert von Talia Bachir-Loopuyt und Gesa zur Nieden.
Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Gesa zur Nieden
Professorin für Musikwissenschaft
Frauen in der Forschung: Dora Benjamins Dissertation über „Die soziale Lage der Berliner Konfektionsarbeiterinnen“

Brandaktuell ist das Thema in den letzten Monaten wieder geworden, das die 23-jährige Dora Benjamin in ihrer 1924 abgeschlossenen Greifswalder Doktorarbeit behandelte: Es ging um Heimarbeit – derzeit als „Homeoffice“ in aller Munde – und insbesondere um deren Folgen für Mütter und ihre Kinder. Im Ergebnis betonte sie vor allem die Nachteile der Heimarbeit. Die Heimarbeiterinnen waren einer starken Belastung ausgesetzt und wurden ausgesprochen schlecht entlohnt. Außerdem hielt Benjamin fest, dass die Kinder der Heimarbeiterinnen in ihrer frühkindlichen Entwicklung litten, da sie nur selten in den Kindergarten geschickt würden, ihre Mütter ihnen aber nicht die gebührende Zeit widmen konnten.
Wie überdurchschnittlich viele der ersten Studentinnen stammte Dora Benjamin aus dem akkulturierten jüdischen Bürgertum. Während ihre Brüder Walter und Georg Benjamin Philosophie und Medizin studiert hatten, entschied sich Dora mit der Nationalökonomie für ein Studienfach, das sich dem Frauenstudium gegenüber besonders offen zeigte. Einige prominente Nationalökonomen gingen davon aus, dass Frauen für die Untersuchung von Themen, bei denen es um frauenspezifische Aspekte des wirtschaftlichen und sozialen Lebens ging, geeigneter seien als Männer. Diese Vorstellung mag auch bei Doras Themenwahl eine Rolle gespielt haben.
Das Frauenstudium selbst war aber in den 1920er Jahren bei weitem noch keine Normalität. Erst im Wintersemester 1908/09 hatte Preußen das reguläre Universitätsstudium auch für Frauen geöffnet. In den folgenden fünf Jahren lag der Frauenanteil unter den Greifswalder Studierenden bei fünf bis sieben Prozent. Bis 1918 stieg er kriegsbedingt auf 32 Prozent.
Erst 1921, als Dora Benjamin ihr Studium begann, erhielten Frauen das Recht, sich an preußischen Universitäten zu habilitieren. In Greifswald erfolgte die erste Habilitation einer Frau 1924. Akademische Karrieren blieben den Frauen jedoch in der Regel verschlossen. Auch Dora Benjamin verließ die Universität, wenngleich sie bis zu ihrem frühen Lebensende weiterhin wissenschaftlich arbeitete, sofern es ihr die Umstände erlaubten. 1933 floh sie nach Frankreich, 1942 – mittellos und schwer erkrankt – weiter in die Schweiz, wo sie 1946 einem Krebsleiden erlag.
Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Christine G. Krüger
Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit
Das weltweit einzige Carl-Zeiss-Doppelteleskop wird restauriert

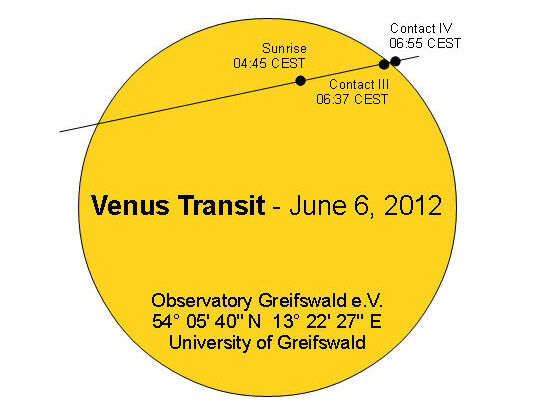

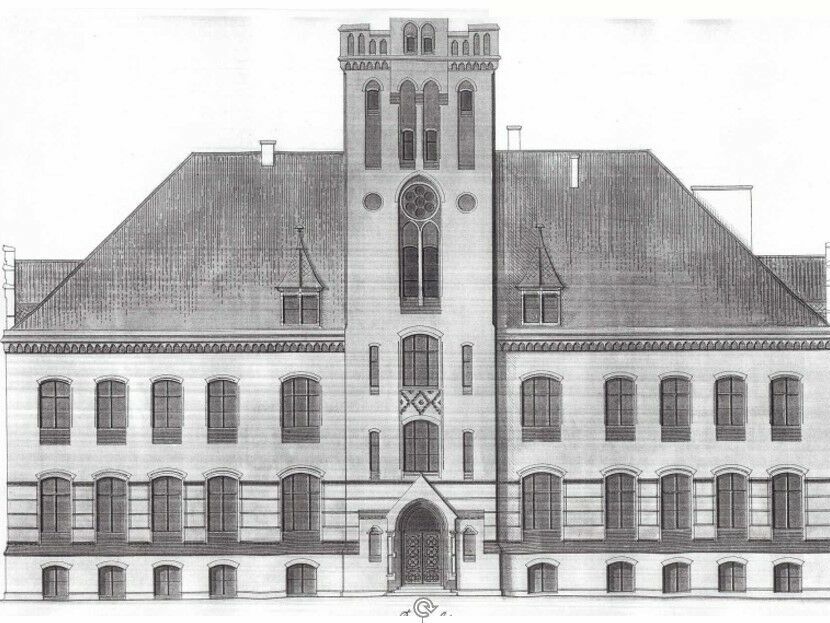

Historische wissenschaftliche Leistungen
Die erste Greifswalder Sonnenbeobachtung ist für das Jahr 1465 belegt. Das damals erwähnte Phänomen der blauen Sonne, wahrscheinlich nach einem Vulkanausbruch, wird auch heute noch wissenschaftlich heiß diskutiert, unter anderem am Institut für Physik mit Christian von Savigny im Bereich der Umweltphysik.
Wissenschaftliche Höhepunkte der Greifswalder Astronomie sind die Beobachtungen der Venus-Transite von 1761 und 1769 durch die Begründer Andreas Mayer (1716–1782) und Lambert Heinrich Röhl (1733–1790). Zum damaligen Zeitpunkt waren in der westlichen Astronomie zwar die relativen Planetenabstände gut bekannt, jedoch fehlte die Kenntnis über die absoluten Abstände. Unterstützt von Astronomen, wie James Cook, und basierend auf dem Vorschlag zur Trigonometrie von Edmond Halley konnte mit den Beobachtungen von Mayer & Röhl erstmalig der absolute Abstand zwischen Sonne und Erde mit circa 150 Millionen Kilometern bestimmt werden. Alle weiteren absoluten Planetenabstände in unserem Sonnensystem lassen sich durch Einsetzen des absoluten Abstandes Sonne-Erde in die Keplerschen Gesetze berechnen.
Röhls genaue Sonnenbeobachtungen erschienen 1761. Große Beachtung fand seine Arbeit von 1768 „Merkwürdigkeiten von den Durchgängen der Venus durch die Sonne“.Als einer der Ersten vermutete er, dass die Venus eine Atmosphäre haben müsse. Die bestätigte Dan Kiselman et. al. im Jahr 2004 von der Royal Swedish Academy of Science.
Das waren große Höhepunkte der damaligen Greifswalder Astronomie in einem der ersten pan-europäischen Wissenschaftsprojekte. Beim nächsten Venus-Transit 1874 fand das Ereignis bereits unsichtbar in der Nacht vor Sonnenaufgang statt. Am 6. Dezember 1882 lag der Venus-Transit ungünstig in den Abendstunden, wobei dem Greifswalder Sternwarte e. V. derzeit keine Beobachtungsaufzeichnungen vorliegen. Kürzlich vom Verein durchgeführte Auswertungen der vom Deutschen Wetterdienst Hamburg dankenswerterweise bereitgestellten Wetterdaten für Kirchdorf/Poel, der am dichtesten gelegenen Wetterstation (circa 130 km entfernt), weisen auf schlechte Sichtbedingungen hin. Es gab eine fast vollständige Himmelsbedeckung von 7,7 (8,0 = volle Bedeckung) und eine relative Luftfeuchte von 91 Prozent.
Die nächste Beobachtung der Venus-Transite erfolgte dann erst wieder in den Jahren 2004 und 2012, unter anderem durch Vereinsgründer Holger Kersten. Damit ist Greifswald eine der wenigen Städte, in denen die Venus-Transite bisher vier Mal beobachtet werden konnten.
100 Jahre Sternwarte auf dem alten Physikalischen Institut (1924–2024)
Beginnend mit der Privatsternwarte von Andreas Mayer in der Martin-Luther-Straße 10 im Jahre 1743 haben die Greifswalder Sternwarten mehrfach den Standort gewechselt. Die letzte auf dem Pulverturm befindliche Sternwarte, am malerisch gelegenen Ryck, musste im September 1826 schließen.
Erst knapp 100 Jahre später, am 12. Juli 1924, bekommt das moderne Physikalische Institut (1888–1891) seine heutige Sternwarte. Dazu wird die bereits vorhandene für meteorologische Beobachtungen genutzte Turmplattform umgebaut unter Friedrich Krüger (1887–1940), dem damaligen Direktor des Astronomisch-Mathematischen Instituts.
Damals wurde zuerst ein 20-cm-Zeiss-Refraktor (Linsenteleskop) mit einer Brennweite von drei Metern angeschafft. Dank der Recherche von Dr. Wolfgang Wimmer vom ZEISS Unternehmensarchiv konnte aus der Serien # 11 800 B das Fertigungsjahr 1921 des leistungsstarken Objektivs E abgeleitet werden. Die Greifswalder Holzkuppel weist große Ähnlichkeiten mit der des berühmten Sonnenobservatoriums im Potsdamer Einsteinturm auf, welches nur wenige Monate später am 6. Dezember 1924, in Betrieb ging.
Moderne Physik und veränderliche Sterne
Zwischen 1835 und 1850 arbeitete in Greifswald der führende Mechanicus und Instrumentenmacher Friedrich Adolph Norbert (1806-1881), der hervorragende Mikroskope, astronomische Uhren, Quadranten und ähnliches baute. Beispielsweise benutzte der schwedische Spektroskopiker Angström eines der etwa briefmarkengroßen Norbertschen Beugungsgitter mit seinen 12 000 Rillen zum Entwickeln eines Linienatlas im Sonnenspektrum. Dieser von Anders Jonas Angström (1814–1874) entwickelte Atlas bildete lange Zeit die Grundlage zum Bestimmen der Wellenlänge. Als Norberts Nachfolger hatte sich auch Carl Zeiss aus Jena beworben. Jedoch konnte er sich mit der Universität Greifswald nicht einigen, so dass er kurze Zeit später in Jena durchstartete.
Um den damals schon berühmten Paul ten Bruggencate (1901–1961) nach Greifswald zu holen, entschließt man sich das vorhandene Teleskop um ein 40-cm-Newton-Reflektor (Spiegelteleskop, 400 / 6.400) zu ergänzen. Die Serien # 16 379 belegt das Fertigungsjahr 1934 und die Inbetriebnahme erfolgte 1935. Damit ist das weltweit einzige Carl-Zeiss-Doppelteleskop komplett.
Mit der Anschaffung eines Spiegelteleskops sollten insbesondere durch fotografische Aufnahmen und spektroskopische Untersuchungen die veränderlichen Sterne näher betrachtet werden. Veränderliche Sterne, sind die, die regelmäßig ihre Helligkeiten verändern, wie zum Beispiel die Plejaden (japanisch Subaru). Durch den frühzeitigen Weggang von Paul ten Bruggencate wurde das Spiegelteleskop allerdings nie richtig wissenschaftlich genutzt. Ten Bruggencate, mittlerweile habilitiert, nahm 1935 seine Arbeit als Hauptobservator am Astro-physikalischen Observatorium im bereits erwähntem Potsdamer Einsteinturm auf.
Dank der friedlichen Übergabe der Stadt zu Ende des Zweiten Weltkrieges kann das weltweit einzige Carl-Zeiss-Doppelteleskop in Greifswald verbleiben. Hobbyastronomen wie Erwin Strübing (1916–2003) oder auch Joachim Buhrow (1927–2014) kümmern sich jahrelang um die Sternwarte bis zur Vereinsgründung.
Generalrestaurierung 2024
Auch das beste Zeiss-Teleskop muss nach über 95 Jahren des zuverlässigen Betriebes in die Restaurierungsferien geschickt werden. Anfang Februar 2021 beginnt die Restaurierung des weltweit einzigen Carl-Zeiss-Doppelteleskops. Das restaurierte Teleskop wird zum Herbst 2021 in Greifswald zurückerwartet.
Weitere Informationen über die Generalrestaurierung 2024, über die Arbeit des Greifswalder Sternwarte e. V. und über Greifswalder Astronomie-Förderpreise finden Sie in dieser PDF.
Weitere Informationen
Medieninfo „ZEISS unterstützt Sternwarte Greifswald mit 50.000 Euro"
Ansprechpartner
Dr. Tobias Röwf
Vorstandsvorsitzender
Greifswalder Sternwarte e. V.
an der Universität Greifswald
sternwarte-greifswaldwebde
Zum Festjahr: „1700 Jahre Geschichte in 90 Sekunden“
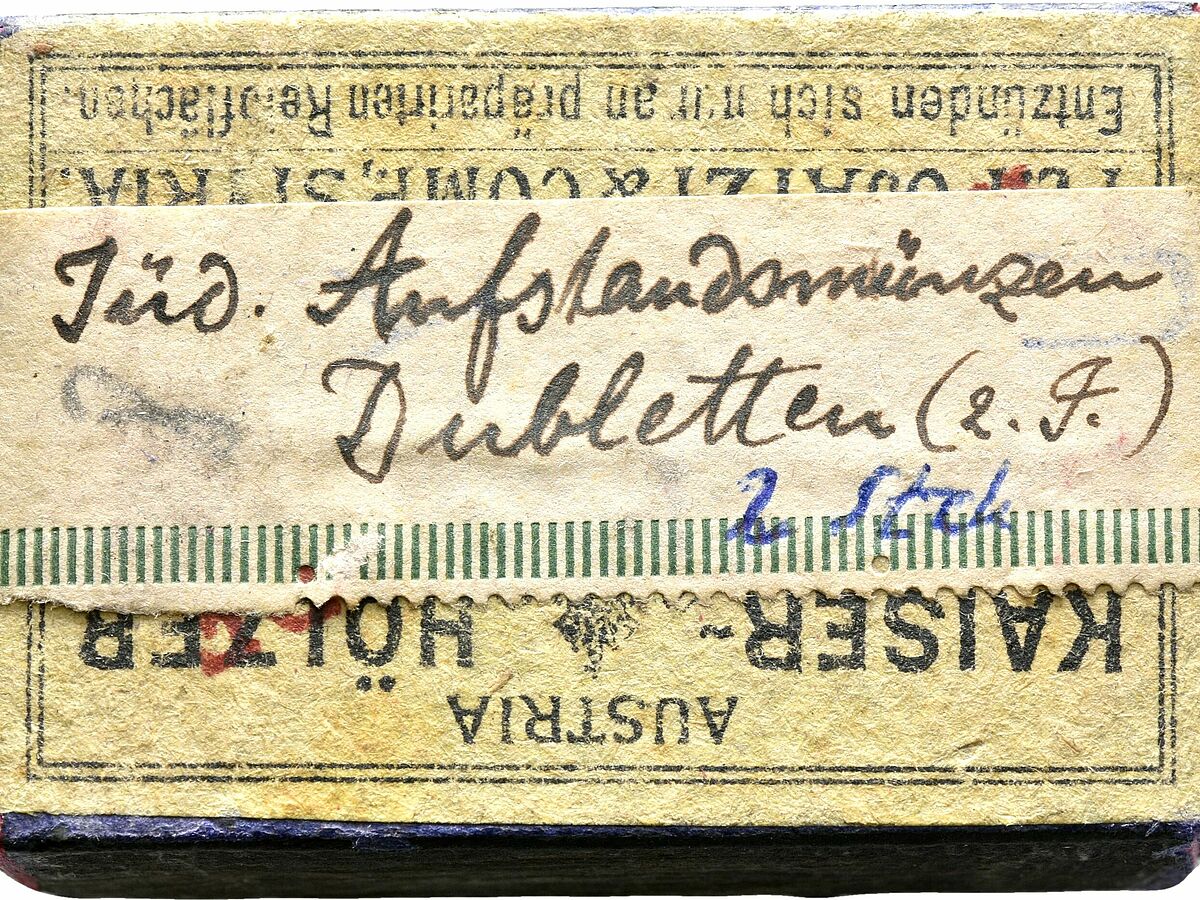


Seit 1700 Jahren lässt sich jüdisches Leben in Deutschland nachweisen. In Greifswald ist die erste jüdische Ansiedlung für das frühe 14. Jahrhundert belegt. Bis heute lassen sich in Vorpommern die unterschiedlichsten Spuren dieser wechselvollen Geschichte finden: zwischen Ausgrenzung und Zusammenleben, zwischen Verfolgung und aktiver Teilhabe. Zum bundesweiten Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ haben sich kulturelle Akteur*innen in Greifswald zusammengetan. Gemeinsam wollen sie erlebbar machen, wie Jüd*innen – trotz teils widriger Umstände – die Stadt über Jahrhunderte geprägt haben. Auch die Universität Greifswald ist mit Beiträgen vertreten, dazu gehört das virtuelle Angebot „1700 Jahre in 90 Sekunden“. Das Gustaf-Dalman-Institut stellt darin besondere Sammlungsstücke vor, die einen Blick in die jüdische Geschichte ermöglichen.
Seit 100 Jahren verwahrt das Greifswalder Dalman-Institut eine europaweit einmalige Sammlung, die einen Rundumblick auf die Kulturlandschaft Palästina um 1900 ermöglicht: vom Gebetsriemen bis zum archäologischen Fundstück, vom gepressten Olivenzweig bis zur Fotografie jüdischer Trauerriten. Die Sammlung ist eng in das universitäre Lehren und Forschen eingebunden. Ebenso werden die Inhalte regelmäßig einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit „1700 Jahre in 90 Sekunden“ wird – virtuell und prägnant – zum Festjahr jeden Monat ein neues Artefakt vorgestellt. In nur 90 Sekunden Lesezeit können Interessierte eintauchen in die jüdische Geschichte und ihren Bezug zur Greifswalder Sammlung. Im Januar steht der Beitrag unter dem Titel „Aufstand in der Streichholzschachtel“.
In der kleinsten Schachtel steckt oft die größte Überraschung: Als erstes „Jüdisches Artefakt des Monats“ zeigt das Dalman-Institut eine Münze von 67 nach unserer Zeitrechnung (n.u.Z.). Oder, um den hebräischen Buchstaben auf der Vorderseite zu folgen, aus dem „Jahr 2“ (daneben eine Amphore). Bereits ein Jahr zuvor hatte sich der erste Jüdische Aufstand gegen die römische Besatzung aufgelehnt. Entsprechend selbstbewusst trägt die Rückseite der Münze eine Weinranke und den Schriftzug: „Freiheit Zions“. Eine Selbstständigkeit, die schon kurz darauf enden sollte. Denn 70 n.u.Z. eroberten die Römer erneut Jerusalem. Gut drei Jahre später unterlag mit der Festung Masada dann der letzte Rückzugsort der Bewegung. Zwei weitere Aufstände dieser Art sollten bis 135 n.u.Z. folgen, die beide ebenfalls unterlagen.
Die rund 600 historischen Münzen der Dalman-Sammlung wurden in den vergangenen Monaten hervorgeholt, fotografiert, beschrieben und online zugänglich gemacht – in Zusammenarbeit mit der Kustodie der Universität Greifswald und dem Forschungsverbund NUMiD. Bei den Stücken, die der Sammlungsgründer Gustaf Dalman (1855–1941) selbst bestimmt hat, ist oft die Verpackung mindestens ebenso interessant wie der Inhalt. In diesem Fall steckt die oben beschriebene Münze in einer alten Streichholzschachtel. Auf dem Deckel trägt ein Klebezettel, wie vom Rand eines Briefmarkenbogens abgerissen, in Dalmans Handschrift den Hinweis: „Jüd. Aufstandsmünzen. Dubletten“, denn im Inneren finden sich zwei fast identische Exemplare. Ursprünglich, wohl im frühen 20. Jahrhundert, lag in der Schachtel ein Fabrikat der Firma „Kaiser“. Immerhin handelte es sich um fortschrittliche „Sicherheitshölzer“, wie stolz beworben wird: „Entzünden sich nur an präparirten Reibeflächen“. Bis heute schützt die recycelte Verpackung in Greifswald zwei Münzen, die auf eine Wegmarke der jüdischen Geschichte verweisen.
Weitere Informationen
In Greifswald haben sich der Arbeitskreis „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zusammengetan, um gemeinsam einen Beitrag zum Festjahr zu leisten. Dazu gehören der Arbeitskreis Kirche und Judentum, die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, das Gustaf-Dalman-Institut, die Kustodie der Universität Greifswald, die Stadtbibliothek „Hans Fallada“, das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, die Partnerschaft für Demokratie Greifswald, das Pommersche Landesmuseum, das Koeppenhaus sowie die Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit dem Amt für Bildung, Kultur und Sport als koordinierendes Amt.
Greifswalder Festjahresprogramm im ersten Quartal
Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen startet das Festjahresprogramm virtuell. Bereits jetzt lassen Plakate, Postkarten und Online-Informationen „Jiddische Wörter im Alltag“ lebendig werden.
Interessierte online an einem digitalen Stadtrundgang zur jüdischen Geschichte in Greifswald teilnehmen.
Ansprechpartnerin
Dr. Karin Berkemann
Warum „Rückführungspatenschaften“ und „Corona-Diktatur“ die Unwörter des Jahres 2020 sind

Seit dreißig Jahren wird Mitte Januar das „Unwort des Jahres“ auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Zuvor sitzen die Mitglieder der Jury in der Regel fünf bis sechs Stunden zusammen, diskutieren mögliche Unwörter, argumentieren, wägen ab, entscheiden sich schließlich für ein Unwort und begründen die Wahl schriftlich in Form einer Pressemitteilung. So war es neunundzwanzig Jahre lang, nur in diesem Jahr war – wie ja eigentlich überall – auch beim Unwort einiges anders: Es gab keine Pressekonferenz, sondern nur die Verteilung der Presseerklärung per E-Mail; keine Präsenz-Jurysitzung, sondern ein digitales Zoom-Meeting; und vor allem gab es kein „Unwort des Jahres“, sondern ein „Unwort-Paar des Jahres 2020“: Rückführungspatenschaften und Corona-Diktatur.
Die Universität Greifswald hat einen besonderen Draht zum „Unwort“, genauer: zur Jury der sprachkritischen Aktion „Unwort des Jahres“, wie es offiziell heißt. Seit zehn Jahren ist Prof. Dr. Jürgen Schiewe, von 2003 bis 2018 Inhaber des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft und nun im Ruhestand, einer der Juror*innen. Insgesamt besteht die Jury aus ständigen festen Mitgliedern, vier Sprachwissenschaftler*innen und einem Journalisten: Prof. Dr. Nina Janich (Darmstadt) als Sprecherin der Jury, zudem Prof. Dr. Kersten Sven Roth (Magdeburg) und Prof. Dr. Martin Wengeler (Trier) sowie Stephan Hebel, Autor und freier Journalist. Diese Jury bittet in jedem Jahr ein weiteres Mitglied um Mitarbeit – in diesem Jahr war es die Journalistin, Bloggerin und Autorin Kübra Gümüşay, die kürzlich das Buch „Sprache und Sein” (2020) publiziert hat.
In diesem Jahr ist auch für die Jury eine Neuigkeit zu melden: Ab dem nächsten Jahr wird es eine komplett neue Jury geben. Sie wird vor allem jünger sein und mindestens genauso motiviert wie die bisherige.
Was aber sind denn nun „Unwörter“? Es sind Wörter, die in dem betreffenden Jahr öffentlich gebraucht wurden und die in ihrem Gebrauch oder sogar bereits in ihrer Gestalt gegen das Prinzip der Menschenwürde und gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen, die einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminieren und euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend sind. Nicht alle diese Kriterien müssen erfüllt sein, aber zumindest muss eines deutlich hervortreten oder aus dem Gebrauch des Wortes erschließbar sein.
Die Jury-Entscheidung beruht in der Regel auf den das gesamte Jahr über eingesandten Vorschlägen interessierter Menschen. Für 2020 gab es 1826 Einsendungen mit 625 verschiedenen Wörtern. Davon entsprachen allerdings nur etwas mehr als 70 den genannten Kriterien. Dass nur so wenige der eingesandten Wörter als Unwörter prinzipiell in Frage kommen, liegt zumeist daran, dass Sache und Wort verwechselt oder gleichgesetzt werden. So ist z. B. „systemrelevant“ kein Unwort (obwohl 180mal und damit am häufigsten eingesandt), denn das „Wort“ entspricht keinem der genannten Kriterien. Die „Sache“, nämlich dass Menschen oder Branchen für die Aufrechterhaltung unseres Gesellschaftssystems als „relevant“ und – im Umkehrschluss – andere als „weniger relevant“ oder gar „irrelevant“ angesehen werden, mag ungerecht und vielleicht gar inhuman sein – im Wort drückt sich das aber nicht aus.
Anders ist das bei „Rückführungspatenschaften“, ein Wort, das von der EU-Kommission gebraucht wurde: EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollen ihre „Solidarität“ mit den anderen Mitgliedern der EU dadurch gerecht werden, dass sie die Verantwortung für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber übernehmen. So etwas „Rückführungspatenschaften“ zu nennen, ist, so die Begründung der Jury, „zynisch und beschönigend“. „Rückführung“ nämlich ist nichts anderes als „Abschiebung“, klingt aber viel humaner. Eine „Patenschaft“ suggeriert „Unterstützung“ und „Hilfe“. „Rückführungspatenschaften“ ist ein typisches Unwort: Die Kombination der Bestandteile des zusammengesetzten Wortes ergibt eine positive Vorstellung von einem – jedenfalls für die Betroffenen – keineswegs positivem Vorgang.
Das Wort „Corona-Diktatur“ wird vor allem von der selbst ernannten „Querdenker“-Bewegung, insbesondere von deren rechtsextremen Propagandisten, gebraucht, um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu diskreditieren. Gewiss greifen diese Maßnahmen gravierend in unser Leben, auch in unsere Grundrechte, ein. Sie aber als „Diktatur“ zu bezeichnen, verharmlost tatsächliche Diktaturen und verhöhnt jene Menschen, die teils unter Einsatz ihres Lebens gegen Diktatoren und ihre Unterdrückungen kämpfen. Und ein Blick in die Geschichte, gerade auch die deutsche, würde zeigen, dass wir keineswegs in einer Diktatur leben.
Warum nun zwei Unwörter für 2020? Die Jury war sich einig, dass das Thema „Corona-Pandemie“ das Jahr über bestimmend war (und auch weiterhin bestimmend bleiben wird) und viele neue Wörter um dieses Thema herum geprägt wurden. Zwangsläufig waren auch Unwörter dabei, ganz vorne: „Corona-Diktatur“. Aber auch andere öffentliche, unsere Gesellschaft und die Politik betreffende Themen – wie die Migration – dürfen nicht vergessen werden. Und hier war und ist „Rückführungspatenschaften“ ein besonders bedrückendes Unwort.
Dass für 2020 zwei Unwörter benannt wurden, drückt nicht nur die Besonderheit dieses Jahres aus, sondern soll auch darauf hinweisen, dass die ganze Aktion keineswegs, wie ihr gelegentlich vorgeworfen wurde, als Zensurversuch zu verstehen ist. Vielmehr möchte sie dazu anregen, über öffentlichen Sprachgebrauch kritisch nachzudenken und zu diskutieren – im Sinne von Humanität, Demokratie und Toleranz.
Weitere Informationen
Vorschläge für das „Unwort des Jahres“ können jederzeit zugesandt werden an: vorschlaegeunwortdesjahresnet
Noch ein Tipp: Seit einigen Jahren setzt eine Gruppe Darmstädter Fotograf*innen das „Unwort des Jahres“ in Bildern um. Die Ausstellung für das Unwort-Paar 2020 ist ab März zu sehen: www.unwort-bilder.de.
Ansprechpartner
Prof. Dr. i.R. Jürgen Schiewe
Was macht uns Angst?

Angst und Panik kennen wir alle. Von einer Störung ist die Rede, wenn diese Emotionen zu einem starken Leidensdruck oder zu einer starken funktionellen Beeinträchtigung führen. Angststörungen gehören zu den häufig auftretenden psychischen Störungen. Laut SHIP-Studie sind Menschen aus Vorpommern mit einer Häufigkeit von 14,8 Prozent in 12 Monaten betroffen. 23,4 Prozent der Menschen haben im Laufe ihres Lebens bereits unter einer Angststörung gelitten. Damit gehören Ängste zu den häufigsten seelischen Störungen in der Region.
***
Frau K. leidet an einer ausgeprägten Spinnenphobie. Heute muss sie selbst Kartoffeln aus dem Keller holen. Dort hat sie früher einmal eine dicke Hauswinkelspinne gesehen. Schon beim Betreten des Kellers hat sie ausgeprägte Erwartungsangst (Pre-Encounter Defense). Sie achtet auf jede kleine Bewegung, inspiziert jeden schwarzen Punkt an der Wand und sucht alle Ecken und Winkel nach Spinnen ab. Als sie eine Spinne in der oberen Ecke des Kellerraums entdeckt, fängt ihr Puls an, schneller zu schlagen. Sie bekommt feuchte Hände und springt schreckhaft zur Seite (Post-Encounter Defense). Dabei berührt sie mit den Schultern eine herabhängende Wäscheleine. Nun setzt sich die Spinne in Bewegung und rennt schnell auf Frau K. zu. Schreiend läuft Frau K. die Treppe hinauf (Circa-Strike). Dabei stößt sie sich den Kopf an der niedrigen Tür. Den Schmerz spürt Frau K. erst, als sie in der Küche in Sicherheit ist. Sie geht anschließend lieber in den Supermarkt, um neue Kartoffeln zu kaufen, statt nochmals den Keller zu betreten.
Herr S. leidet in den letzten Jahren zunehmend an der Furcht vor Situationen, in denen er sich eingeschlossen fühlt und meint, nicht entkommen zu können. Er hat Angst Aufzug, U-Bahn oder Auto zu fahren. Die Furcht tritt nur in Situationen räumlicher Enge auf. Dort erlebt er starke körperliche Symptome wie Herzrasen, Schwitzen, Luftnot, aber auch Schwindelgefühle. Er befürchtet im Ernstfall, nicht aus der Situation herauszukommen, zu ersticken und so zu sterben. Daher vermeidet er solche Situationen meist. Wenn das nicht möglich ist, versucht er die Situationen unter großen Angstgefühlen durchzustehen. Dabei setzt er verschiedene taktische Manöver ein: Ablenkung durch entspannende Gedanken oder durch Gespräche mit anderen Leuten. Seit seiner ersten Furchtreaktion in einem überfüllten Skibus nehmen seine Angst vor Enge und die damit verbundenen Vermeidungsstrategien einen immer größeren Raum ein.
***
Herr S. und Frau K. leiden unter einer sogenannten Spezifischen Phobie. Damit wird eine intensive Furcht vor genau umschriebenen Situationen oder Objekten beschrieben. Forschende der Universität Greifswald untersuchen die Mechanismen, die diese Ängste und die damit verbundenen Verhaltensweisen aktivieren. Welche Regionen des Gehirns übernehmen in welcher Phase die Steuerung des dynamischen Geschehens? Und wann setzt das Vermeidungsverhalten – der Symptombereich, der zu den stärksten funktionellen Beeinträchtigungen führt – ein?
Spezifische Phobien sind am weitesten verbreitet. Am häufigsten haben Menschen eine intensive Furcht vor bestimmten Tieren. Aber auch Naturereignissen wie Gewitter oder Dunkelheit sowie Situationen wie Höhe oder Enge können Angst auslösen. Die Furcht ist mit dem starken Drang gekoppelt, der angstauslösenden Situation zu entfliehen oder sie bereits im Vorfeld zu vermeiden. Werden Betroffene mit der angstauslösenden Situation konfrontiert, gibt es zwei Reaktionsmuster: Sie frieren ein – eine eher durch den Vagusnerv initiierte Bewegungsstarre – oder flüchten. In diesem Fall übernimmt der Sympathikus die Steuerung des Körpers.
Solange sich das angstauslösende Objekt vermeiden lässt, können Betroffene meist ganz gut mit ihrer Angst leben. Schwieriger wird es, wenn Menschen Angst vor sozialen Situationen haben – etwa Angst davor, zu versagen, sich zu blamieren oder abgewertet zu werden. Situationen, in denen diese Form der Angst auftritt, können nur ganz schwer gemieden werden. Schließlich müssten wir dazu Sozialkontakte einstellen. Tatsächlich schränken viele Menschen, die unter sozialen Angststörungen leiden, ihre Sozialkontakte auf das Nötigste ein. Das führt häufig zu depressiven Folgeerkrankungen.
Darüber hinaus gibt es Angststörungen, bei denen die Bedrohung nicht von außen, sondern vom eigenen Körper ausgeht. In diesem Fall sprechen Psycholog*innen von Panikattacken. Sie treten häufig aus heiterem Himmel auf und äußern sich durch das Gefühl, plötzlich unerklärliches Herzrasen oder Schwindelgefühle zu bekommen. Auch das Gefühl zu ersticken, plagt einige Menschen. Panikattacken treten zu 95 Prozent außerhalb des häuslichen Umfeldes auf und können dazu führen, dass Betroffene Situationen meiden, in denen die Panikattacke auftritt. Außerdem machen sich Menschen, die unter dieser Art der Angststörung leiden, oft Sorgen, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt, obwohl ihnen Fachleute versichern, dass sie gesund sind. Die Diagnose erklärt jedoch nicht die Symptome. Das kann die betroffenen Menschen stark verunsichern.
Wie genau Angst, Furcht und Panik sich in unserem Körper manifestieren, das wird davon bestimmt, wie nahe oder intensiv die Bedrohung ist, und welche Handlungsalternativen es gibt. Es macht einen Unterschied, ob wir in einer Situation sind, in der wir die Bedrohung bereits erlebt haben, oder ob wir von anderen nur gehört haben, dass diese Situation gefährlich werden kann, selbst jedoch noch nicht in Kontakt mit der Bedrohung gekommen sind. Wie aufmerksam und vorsichtig wir gegenüber Anzeichen der Bedrohung sind, hängt also von der empfundenen Intensität der Bedrohung ab. Das Covid-19-Virus ist dafür ein gutes Beispiel.
In der Forschung zu Angststörungen werden experimentelle Anordnungen verwendet, etwa um die Dynamik defensiver Verhaltensweisen zu verstehen. Funktionelle Kernspintomographie dient beispielsweise dazu, die regulierenden Hirnbereiche zu erforschen. Forschende wissen heute, dass bei der Erwartungsangst – also der Angst vor der Sichtung der potenziellen Bedrohung – vor allem präfrontale Areale aktiv sind. Das Gehirn beschäftigt sich primär mit der Risikoabschätzung. Leider können wir komplexe bedingte Wahrscheinlichkeiten nicht besonders gut einschätzen. Je näher die Bedrohung kommt, desto eher schaltet das Gehirn auf Notfallmodus. Das bedeutet, der Präfrontale Kortex reduziert seine Aktivität zugunsten der Hirnstammfunktionen. Wir reagieren dann auf eine Weise, die uns im Nachhinein manchmal peinlich ist. In klinischen Studien wird untersucht, wie Menschen ihre Risikoeinschätzungen überprüfen. Proband*innen lernen, Erfahrungen im Gedächtnis zu verankern, in denen die befürchtete Bedrohung nicht aufgetreten ist. Solche Erfahrungsübungen – auch bekannt als Expositionstherapie – sind der Königsweg zur Überwindung der Angst. In großen klinischen Studien wurden an der Universität Greifswald inzwischen über 1000 Patienten mit dieser Methode erfolgreich behandelt. Je besser wir die Wirkmechanismen verstehen, desto länger wird der Erfolg solcher Therapien in Zukunft anhalten.
Ansprechpartner
Prof. Dr. Alfons Hamm
Nudging: Dürfen wir kluge Entscheidungen anstoßen?

Das Idealbild vom nutzenmaximierenden Homo Oeconomicus bröckelt (nicht erst seit Kurzem). Anstelle des stets rational abwägenden Mr. Spock ähneln wir in vielen Entscheidungssituationen viel häufiger dem guten alten Homer Simpson, berichtet Richard Thaler, Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften und Co-Autor des Buches „Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt“. Wir treffen schnelle Bauchentscheidungen und nutzen Daumenregeln. Besonders in komplexen oder ungewohnten Situationen greifen wir auf vereinfachende Kalkulationen (Heuristiken) zurück, mit denen wir im Alltag häufig zwar keine optimalen, jedoch hinreichend gute Entscheidungen treffen können.
In vielen Situationen schafft uns diese schnelle und intuitive Art des Denkens Erleichterung für unseren Alltag. Doch wer hat das nicht schon einmal erlebt: Wenige Wochen sind vergangen, und die Vorsätze für das neue Jahr sind vergessen. Der Sport weicht dem Platz auf dem Sofa, der gesunde Salat dem himmlisch duftenden Schokopudding und das unliebsame Zeitschriftenabonnement wurde noch immer nicht gekündigt. Wir werden unseren Vorsätzen nicht gerecht und ärgern uns über das Ergebnis unseres Tuns. Nicht immer steuert uns unser innerer Homer Simpson in die richtige Richtung. So sind wir anfällig für kognitive Verzerrungen und systematische Fehlurteile (Biases) wie zum Beispiel Selbstüberschätzung und unberechtigten Optimismus durch fehlerhafte Wahrscheinlichkeitskalkulationen, eine größere Gewichtung kurzfristiger Präferenzen gegenüber langfristigen Zielen und eine Tendenz zur Erhaltung des Status quo.
Mit ihrer 2008 veröffentlichten Strategie des Nudging versprechen Thaler und Sunstein einen Lösungsansatz für dieses Problem. Die beiden Wissenschaftler plädieren dafür, die Erkenntnisse über das menschliche Entscheidungsverhalten zu nutzen und den Entscheidungskontext von Personen gezielt so zu gestalten, dass wir im Entscheidungsmodus unseres Homer Simpsons verbleiben und dennoch bessere Entscheidungen treffen können. Durch das vorausschauende Austricksen unseres inneren Homer Simpsons, kämen wir den Entscheidungen näher, die auch unser innerer Mr. Spock in dieser Situation getroffen hätte.
Nudging heißt der Ansatz aus der Verhaltensökonomie, mit dem Menschen durch einen kleinen Schubs [engl. nudge] dazu bewegt werden sollen, die „richtigen“ Entscheidungen zu treffen, ohne dabei ihre Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Grüne Fußspuren, die uns den Weg zum Mülleimer weisen; kleinere Teller in der Mensa, um Essensreste zu vermeiden und doppelseitiges Drucken als Voreinstellung in der Software – all dies sind Beispiele für Nudges.
Das Promotionsprojekt „Nudging im Namen der Umweltsorge? Eine ethische Reflexion auf den Schubs über die Kluft zwischen Wissen und Handeln“ erforscht Nudging im Rahmen des interdisziplinären Promotionsschwerpunktes Dimensionen der Sorge am Institut für Philosophie an dieser Schnittstelle zwischen empowernder Sorgehandlung und paternalistischer Manipulation. Kann Nudging uns dabei unterstützen, im Einklang mit unseren Wünschen und Werten zu handeln oder muss diese verhaltenspsychologische Strategie als unterschwelliger Eingriff in unsere Autonomie abgelehnt werden? Welche Bedeutung kommt der Strategie des Nudging im Kontext der Bestrebungen um Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu? Für eine differenzierte Betrachtung und normative Bewertung von Nudges werden im Projekt verschiedene Nudge-Typen ausgehend vom Grad ihrer Transparenz und ihrer Eingriffstiefe unterschieden und die Effektivität und Legitimität dieser Steuerungsmaßnahme im Kontext der Sorge um die Umwelt untersucht.
Ansprechpartner*innen
Birthe Frenzel M. Sc.
Prof. Dr. Micha H. Werner
Linguistik zur Weihnachtszeitszeit

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, geprägt also von innerer Einkehr. In dem gerade erschienenen Buch „Weihnachtslinguistik. Festliche Texte über Sprache“ ist die Herausgeberin, Konstanze Marx, gemeinsam mit den Autor*innen quasi eingekehrt in das eigene Fach, um es in seiner schillernden Breite in Glanzpapier zu verpacken. In den Blick genommen werden in dem Buch kommunikative Praktiken des Wünschens beim Einkaufen, in Briefen, über WhatsApp, in direktem Austausch am Weihnachtsabend oder medial vermittelt, wie beispielsweise bei den bundespräsidialen Weihnachtsansprachen sowie kulturelle Praktiken des Vorlesens, etymologische und lexikographische Perspektiven auf Pelzmärtel, Krampus, Nikolaus oder Knecht Ruprecht, syntaktische Besonderheiten oder Varietäten in Weihnachtsliedern, genderlinguistische Erhellungen bei Loriot oder der Zusammenhang zwischen Witzen und Weihnachten.
Vom Wort
Begonnen sei beim Wort, vielmehr bei Wortgeschichten: So ist zum Beispiel das Bestimmungswort in Lebkuchen nicht sicher zu deuten. Wofür könnte es stehen, fragt sich etwa Gabriele Diewald, für Lieb, Leib, Leben? Wolfgang Pfeifer et al. vermuten im Etymologischen Wörterbuch des Deutschen, dass das Leb auf Laib zurückgeht oder auch eine Entlehnung aus dem lateinischen lībum (Fladen) ist. Noch umstrittener ist die Etymologie von Spekulatius, sie reicht von ,Zuckerbackwerk als Tischschmuck‘ (aus dem Niederländischen) über ,Betrachtung, Beschauung‘ (aus lat. speculātio) bis hin zu ,Erzeugnisse zum Wohlgefallen‘ (nach dem Französischen). Hier besteht also viel Unsicherheit.
Sicher ist aber, dass Wörter online nachgeschlagen werden, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, dass die Zugriffe auf den Eintrag Nikolaus am Nikolaustag und auf den Eintrag Weihnachten am 24. Dezember sprunghaft ansteigen. Sascha Wolfer spricht deshalb vom „Effekt der sozialen Relevanz“, der übrigens auch an Ostern nachweisbar ist.
Über den Satz
Auch die Satzebene beherbergt interessante weihnachtliche Phänomene, Phänomene, die es eigentlich in der deutschen Satzstellung gar nicht gibt. So verstoßen Weihnachtslieder wie Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen oder Süßer die Glocken nie klingen (der eine oder die andere fühlt sich schon jetzt zurecht an Yoda erinnert) gegen die drei möglichen Verbstellungsvarianten im Deutschen. Finite Verben können am Ende eines Satzes stehen (wie in Nebensätzen), am Anfang (wie in Fragesätzen) oder an zweiter Stelle; das ist in Aussagesätzen der Fall und dann steht aber auch nur einzige Konstituente davor – im sogenannten Vorfeld. Wolfgang Imo setzt also den Rotstift an und zeigt, wie es eigentlich heißen müsste: Die Lichter brennen am Weihnachtsbaume oder Am Weihnachtsbaume brennen die Lichter und identifiziert hier eine weihnachtlich reiche (mehrfache) Vorfeldbesetzung.
Zum Text
Der Textebene sei ebenfalls eine Stippvisite abgestattet: So hat Simon Meier-Vieracker mittels korpuslinguistischer Keywordanalysen herausgefunden, dass in allen bisherigen bundespräsidialen Weihnachtsansprachen neben erwartbaren Ausdrücken (wie beispielsweise Weihnachten, Licht, Botschaft, Freude, Geburt oder Liebe) auch politische Topoi und mentalitätgeschichtliche Gestimmtheit der jeweiligen Amtsinhaber einfließen. Juliane Stude hat von Kindern verfasste Weihnachtsgeschichten untersucht und konnte damit das große Geheimnis hinter der Frage, wie die Geschenke zu den Kindern kommen, lüften: In einem „Inter Citi Express“, dort hat „der Weihnachtsmann [nämlich] einen eigenen Waggon“.
Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Konstanze Marx
Wie andere Ernährungsgewohnheiten einen Beitrag zum Schutz von Süßwasserökosystemen leisten könnten

Die globale Nahrungsmittelproduktion steht vor einer doppelten Herausforderung. Für eine wachsende Weltbevölkerung müssen mehr Nahrungsmittel produziert werden. Gleichzeitig trägt die Landwirtschaft schon jetzt zur Überschreitung sogenannter planetarer Belastungsgrenzen (engl. „planetary boundaries“) bei und gefährdet damit die natürlichen Grundlagen der Nahrungsmittelproduktion. Neben der Auslaugung sowie Überdüngung von Böden, dem Verlust von Biodiversität und dem Beitrag zum Klimawandel ist der hohe landwirtschaftliche Wasserverbrauch ein entscheidendes Problem. Durch übermäßige Wasserentnahmen für die Landwirtschaft werden Süßwasserökosysteme global zunehmend zerstört. Eine Beschränkung der Wasserentnahme zum Schutz der Ökosysteme würde jedoch unweigerlich zu einer Reduktion der globalen Erträge führen.
Um diesen Zielkonflikt zwischen Umweltschutz und Ernährungssicherheit aufzulösen, könnte neben einem verbesserten landwirtschaftlichen Wassermanagement oder einer Reduktion der Nahrungsmittelabfälle auch eine Reduktion tierischer Produkte beitragen. Tierische Produkte haben einen weit überproportionalen Ressourcenverbrauch im Verhältnis zu ihrem Beitrag zur globalen Nahrungsmittelversorgung: Während etwa 18 Prozent der globalen Kalorien aus tierischen Quellen stammen, sind über ein Drittel des Wasserverbrauchs und über 80 Prozent des Flächenverbrauchs in der Lebensmittelproduktion auf tierische Produkte zurückzuführen.*
Basierend auf globalen Landwirtschaftssimulationen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und mehreren Ernährungsszenarien hat Johanna Braun in ihrer Masterarbeit an der Universität Greifswald quantitativ untersucht, inwieweit veränderte Ernährungsgewohnheiten mögliche Ernteeinbußen bei flächendeckendem Schutz von Süßwasserökosystemen kompensieren könnten. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Ernteeinbußen durch eine deutliche Reduktion des Konsums tierischer Produkte sogar überkompensiert werden könnten. Besonders stark sind die Potenziale in Westeuropa und Nordamerika. Die vergleichende Analyse verdeutlicht damit beispielhaft für den landwirtschaftlichen Wasserverbrauch, dass das große Dilemma der Nahrungsmittelproduktion innerhalb der natürlichen Grenzen des Erdsystems unter anderem durch einen Wandel der Ernährungsgewohnheiten auflösbar ist.
Basierend auf globalen Landwirtschaftssimulationen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und mehreren Ernährungsszenarien hat Johanna Braun in ihrer Masterarbeit an der Universität Greifswald quantitativ untersucht, inwieweit veränderte Ernährungsgewohnheiten einen Beitrag dazu leisten könnten, Süßwasserökosysteme zu schützen. Für ihre Arbeit erhielt sie den Nachhaltigkeitspreis 2020 der Universität Greifswald.
* Poore & Nemecek (2018) https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
Woran erinnern uns Stolpersteine?

Am 9. Dezember 2020 wird in Greifswald ein weiterer Stolperstein ins Pflaster eingelassen. Der Stolperstein wird vor dem Haupteingang des Theaters Greifswald in Gedenken an den Schauspieler Kurt Brüssow verlegt, der im Nationalsozialismus als Homosexueller verfolgt wurde. Auch an unserer Uni erinnern Stolpersteine an die Verbrechen des Nationalsozialismus. So ist auf einem Stolperstein vor dem ehemaligen Historischen Institut in der Domstraße 9 A der Name des Historikers Dr. Gerhard Knoche (1893–1944) zu lesen, und ein Stein vor dem Pharmakologischen Institut in der Friedrich-Loeffler-Straße 23 D erinnert an den Geologen Dr. Rudolf Kaufmann (1909–1942). Nach 1933 wurde ihnen der akademische Titel auf Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Beamtentums vom 7. April 1933 (kurz: Berufsbeamtengesetz) aberkannt, unter anderem weil sie Juden waren oder jüdische Vorfahren hatten. Dr. Gerhard Knoche wurde später in Konzentrationslager deportiert. In Auschwitz verliert sich seine Spur. Dr. Rudolf Kaufmann wurde, weil er mit einer jüdischen Witwe liiert war, wegen Rassenschande zur Zwangsarbeit verurteilt. Er entkam den Nationalsozialisten zunächst, wurde 1942 jedoch von deutschen Soldaten in Litauen erschossen.
Stolpersteine und die Geschichte der Universität
Die Stolpersteine führen uns heute vor Augen, inwiefern Lebens- und Leidenswege von Greifswaldern im Nationalsozialismus auch mit der Geschichte unserer Universität verwoben sind. Dr. Gerhard Knoche und Dr. Rudolf Kaufmann – das sind nur zwei von etwa 80 Namen von Gelehrten, denen nach 1933 auf Grundlage des Berufsbeamtengesetzes der akademische Titel aberkannt wurde. Insgesamt wurde etwa jeder zehnte Wissenschaftler an der Universität Greifswald unter dem Gesetz verfolgt. Das Berufsbeamtengesetz öffnete nicht nur Tür und Tor für die Aberkennung von Titeln, sondern auch für Entlassungen jüdischer Dozenten und anderer Mitarbeitenden der Universität. Auch Menschen mit einer unerwünschten (politischen) Gesinnung fielen unter das Gesetz. Samt den zugehörigen Erlassen, die Ausnahmeregelungen für bestimmte Personengruppen zuließen, wurde das Gesetz als flexibles Willkürrecht eingesetzt: „Das Berufsbeamtengesetz und die anderen Erlasse waren jedoch bewusst flexibel gehaltenes Willkürrecht, so dass ausgemustert werden konnte, wer sich für die neue Gesellschaft nicht eignete.“ (Eberle 2015, 95 f.)
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Universität
Über achtzig Wissenschaftler, denen im Nationalsozialismus akademische und Universitätsehrengrade aberkannt wurden, hat der Akademische Senat der Universität Greifswald am 19. Oktober 2000 rehabilitiert. Eine Kommission hatte die dem Universitätsarchiv bisher bekannt gewordenen Fälle zuvor einer Einzelfallprüfung unterzogen. Dabei ergab sich, dass in 53 Fällen das Kriterium der politischen Diskriminierung unbezweifelbar vorlag. Ebenso sind drei Aberkennungen wegen politischer Vergehen und eine Aberkennung wegen Verstoßes gegen die Rassengesetze als offensichtliche Unrechtsakte zu erkennen und nichtig. Die bisher erarbeitete Liste der Personen, bei denen die Aberkennung der akademischen Grade unwirksam ist, ist eine offene Liste. Das heißt, dass neu zu Tage geförderte Namen oder Entlastungsgründe sie verändern können.
Lange Zeit fehlte eine umfassende, tiefgreifende und systematische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Universität Greifswald während des Nationalsozialismus. Es gab jedoch eine große Anzahl wertvoller Einzelstudien von personen-, institutionen-, wissenschafts- und ereignisgeschichtlichen Charakter. Vor diesem Hintergrund rief das Rektorat der Universität Greifswald im Jahr 2011 ein Forschungsprojekt ins Leben, in dem die Geschichte der Universität systematisch untersucht wurde. Das Projekt wurde in den Jahren 2012 bis 2015 durchgeführt. Im Zentrum des Interesses standen dabei die Indienstnahme und Selbstindienstnahme universitärer Forschung und Lehre für außerwissenschaftliche Zwecke, die Frage nach der Mobilisierung von Wissenschaft für die Ziele des Nationalsozialismus sowie nach den Mechanismen, die zu einer neuartigen Konkurrenz der Disziplinen und damit letztlich zu einem Profilwandel der Universität führte. Die Forschungsergebnisse sind in der Monographie „Ein wertvolles Instrument“ – Die Universität Greifswald im Nationalsozialismus von Henrik Eberle ausführlich dargestellt.
Trotz intensiver Recherchen konnten in diesem Forschungsprojekt nicht alle Fragen gleichermaßen befriedigend geklärt werden. Es bleiben Lücken, die künftige Forschungsarbeiten schließen müssen. Die Stolpersteine in Greifswald, Deutschland und anderswo in Europa erinnern uns heute auch daran, dass solche Wissenslücken gefüllt werden müssen.
Weitere Informationen
Literatur
- Alvermann, Dirk (Hg., 2015): „… die letzten Schranken fallen lassen“ – Studien zur Universität Greifswald im Nationalsozialismus. Böhlau Verlag.
- Eberle, Henrik (2015): „Ein wertvolles Instrument“ – Die Universität Greifswald im Nationalsozialismus. Böhlau Verlag.
Zum Projekt Stolpersteine
- Stolpersteine ist ein internationales Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Dabei ließ er sich von Zitat aus dem Talmud leiten, in dem es heißt „Doch ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Im Jahre 1992 verlegte Gunter Demnig die ersten Stolpersteine. Heute finden wir sie an vielen Orten nicht nur in Deutschland. Die ersten elf Stolpersteine in Greifswald wurden 2008 auf Initiative der Evangelische Studiengemeinde verlegt. Im Jahr 2012, in der Nacht vom 8. zum 9. November, wurden diese elf Stolpersteine von Unbekannten herausgerissen. Sie konnten am 23. Mai 2013, den Tag des Grundgesetzes, zusammen mit zwei weiteren Stolpersteinen neu verlegt werden. Am 22. Oktober 2014 wurden weitere 14 Stolpersteine vom Künstler Gunter Demnig in Greifswald verlegt. Erstmals wird dabei auch an ein nichtjüdisches Opfer des Nationalsozialismus erinnert.
Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum im Spannungsfeld von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Erreichbarkeit

Was müssen Krankenhäuser leisten?
Krankenhäuser müssen (mindestens) drei Ziele verfolgen: Erstens müssen sie Gesundheitsdienstleistungen in hoher Qualität erstellen, die wirksam Krankheiten heilen und Leiden lindern können. Zweitens sollten sie für die ganze Bevölkerung in annehmbarer Zeit erreichbar sein, so dass sie für Patient*innen und deren Besucher*innen zugänglich sind. Drittens müssen sie bei gegebener Krankenhausfinanzierung mit den verfügbaren Ressourcen auskommen – also wirtschaftlich handeln. Insbesondere kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum haben größte Probleme, alle drei Ziele gleichzeitig zu erreichen.
Die dünne Bevölkerungsdichte in ländlichen Regionen impliziert eine geringe Krankenhausgröße mit gravierenden Auswirkungen auf Qualität und Kosten. Die Kosten je Patient*in oder Fall sind höher als bei größeren Häusern. Da in Deutschland die Krankenhäuser pro Fall pauschal und unabhängig von ihrer individuellen Kostenstruktur entgolten werden, sind kleinere Krankenhäuser deutlich häufiger in ihrer Existenz bedroht. Die Wirtschaftlichkeit spricht eindeutig für die Schließung der kleineren Einheiten im ländlichen Raum und die Konzentration auf Krankenhauszentren in den Städten.
Sind große Krankenhäuser besser als kleine?
Bei der Qualität ist das Bild nicht so eindeutig. Einerseits haben die größeren Krankenhäuser eine höhere Routine, was zu einer höheren Behandlungsqualität führt. Gerade bei Komplikationen macht es einen großen Unterschied, ob das Behandlungsteam diesen Notfall regelmäßig erlebt oder ob ein vergleichbarer Fall schon länger zurückliegt. Dies spricht ebenso für eine Konzentration auf größere Zentren. Aber die Qualität umfasst nicht nur die Qualität im Krankenhaus, sondern auch auf dem Weg dorthin. Gerade bei Notfällen ist ein schneller Zugang zum Krankenhaus lebenswichtig. Das heißt ein flächendeckendes Netz aus Krankenhäusern ist essenziell, auch wenn diese dann klein sein müssen. Betrachtet man beide Qualitätskomponenten zusammen, so erscheint weder die Konzentration auf wenige Standorte noch die unreflektierte Füllung des Raums mit möglichst vielen Krankenhäusern als qualitätsfördernd.
Die Erreichbarkeit ist aber nicht nur eine Determinante der Leistungsqualität, sondern stellt für Patient*innen und deren Besucher*innen einen Wert per se dar. Eine starke Konzentration von Krankenhäusern auf wenige, große Standorte impliziert eine schlechtere Versorgung der Bevölkerung auf dem Land, Vereinsamung der Patient*innen ohne Besuch und eine geringe Identifikation mit dem Hospital.
Der Konflikt zwischen Qualität, Erreichbarkeit und Wirtschaftlichkeit lässt sich nicht vollständig entschärfen. Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum müssen noch mehr als größere Einheiten bei jeder Entscheidung diese Ziele abwägen und das bestmögliche aus ihren Ressourcen machen. Kleine Krankenhäuser haben aber auch Vorteile. Sie sind überschaubar, familiär und effizient, weil die Wege kurz sind und Mitarbeitende sich kennen. Und sie können die Vorteile größerer Krankenhäuser nutzen, in dem sie mit ihnen kooperieren. So müssen sie beispielsweise keine eigene Pathologie betreiben, sondern können die Dienste des größeren Hauses anfragen. Von zunehmender Bedeutung ist hier die Telemedizin, insbesondere das Telekonsil. Das kleine Haus schaltet den*die Spezialisten*in aus dem Zentralkrankenhaus per Videoschaltung zu, ohne dass dieser vor Ort sein muss. Überhaupt ist innovative Technik ein Schlüssel zur Existenzsicherung der kleineren Häuser. So können beispielsweise Drohnen Laborproben mit hoher Geschwindigkeit vom kleinen Krankenhaus in ein zentrales Labor bringen. Je kleiner ein Krankenhaus ist, desto effizienter und innovativer muss es arbeiten, um überleben zu können.
Wie viel ist uns eine ortsnahe Versorgung wert?
Allerdings liegt die Zukunft der kleineren Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht nur beim Management dieser Einrichtungen. Auch die Politik und damit letztlich alle Bürger*innen sind gefragt: Wie viel ist ihnen eine ortsnahe Versorgung wert? Die Krankenhausfinanzierung kennt das Instrument des Sicherstellungszuschlags. So können beispielsweise Geburtskliniken, die als notwendig erkannt werden, aber auf Grundlage der geringen Fallzahl nicht mit den gegebenen Fallpauschalen auskommen können, zusätzlich vom Bundesland unterstützt werden. Das Instrument wird nur leider von den Ländern höchst selten eingesetzt.
Was lehrt uns die Corona-Pandemie?
Bis Februar 2020 gingen einige Wissenschaftler*innen so weit, kleinere Krankenhäuser als komplett unnötig zu bezeichnen. Sie wollten sie schließen, weil sie unwirtschaftlich, risikoreicher und schlecht ausgelastet waren. Die Corona-Pandemie hat uns aber gelehrt, dass wir diese Notfallkapazitäten dringend brauchen. Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum haben zahlreiche Corona-Patient*innen behandelt und damit den Kollaps der großen Krankenhäuser in den Zentren verhindert. Wir sollten uns deshalb abgewöhnen von „Überkapazitäten“ zu sprechen, sondern lieber von „Notfallkapazitäten“ ausgehen.
Was macht gutes Krankenhausmanagement aus?
Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum bleiben für die Versorgung der Bevölkerung notwendig. Nicht in jedem Einzelfall, aber doch flächendeckend. Und sie bleiben eine Herausforderung, die eine besonders gute Qualifizierung und Motivation der Führungskräfte erfordert. Die Ausbildung der zukünftigen Krankenhausmanager ist eine Aufgabe, der sich die Universität Greifwald in ihrem Master of Science Health Care Management stellt. Nicht, nur für kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum – aber ganz bewusst auch für sie.
Literatur:
- Fleßa, Steffen (2020): Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum: Lösungsmodelle für eine finanzierbare Versorgung. Springer Gabler. DOI: 10.1007/978-3-658-28105-2.
- Fleßa, Steffen (2018): Systemisches Krankenhausmanagement. De Gruyter Oldenbourg. DOI: 10.1515/9783110525687.
- Fleßa, Steffen; Greiner, Wolfgang (2013): Grundlagen der Gesundheitsökonomie: Eine Einführung in das wirtschaftliche Denken im Gesundheitswesen. 4. Auflage. Springer Gabler. DOI: 10.1007/978-3-642-30919-9.
Sammlungsobjekte werden mittels Metadaten für die Forschung nutzbar gemacht

An der Universität Greifswald wurden schon seit Jahrhunderten Gemälde für die Galerie der Gelehrtenporträts gesammelt. Die eigentliche Akademische Kunstsammlung entstand im 19. Jahrhundert, parallel zur Sammlung „Vaterländischer Alterthümer“. In Form von Gipsabgüssen antiker Plastiken, Zeichenvorlagen, Münzen und später auch Fotografien bot sie Einblick in die Ästhetik und Lebenswelt der alten Griechen und Römer. Seit 1989 betreut die Kustodie den gesamten Kunstbesitz der Universität. Heute wird nicht nur die Porträtsammlung vervollständigt. Ein Sammlungsschwerpunkt sind auch bildgebende Instrumente aus der Universitätsgeschichte. Das Sammeln und Pflegen solcher Objekte ist die eine Seite der Aufgaben der Kustodie; das Erforschen, Erschließen und digitale Vernetzen der Sammlungsgegenstände mit normgerechten Metadaten und begleitendem Schriftgut ist die andere, sicher aufwendigere Aufgabe.
Wie wichtig diese Aufgabe ist, zeigen zwei Werke zur Erforschung der Rügener Kreide:
Mitte des 19. Jahrhunderts publizierte Friedrich von Hagenow Zeichnungen von Mikrofossilien der Kreide, die er mit einem von ihm erfundenen optischen Hilfsinstrument anfertigte. Das seltene Instrument befindet sich in der Sammlung der Kustodie. Die Vergleichsfossilien sind Teil der paläontologischen Sammlung und die Bibliothek besitzt die Originalpublikationen des Geologen.
Siebzig Jahre später wirkte der Geologe Otto Jaekel in Greifswald. Er ist heute vor allem bekannt aufgrund seiner Ausgrabungen von Dinosaurierfunden in einer Tongrube bei Halberstadt. Darüber hinaus erforschte er die pommersche Kreideküste. Seine Landschaftsbilder der Bodden- und Kreideküste sind bis heute erhalten. Sie dienten als fachdidaktisches Bildmaterial ihrer Zeit und sind kunsthistorisch interessante Bildwerke.
Der Schlüssel, um solche Bildwerke und Sachzeugen digital auffindbar zu machen und ihre unterschiedlichen Bedeutungsebenen zu beleuchten, ist eine ausgeklügelte Verschlagwortung. Das Rechenzentrum, die Sammlungsleiter*innen und die Kustodie erarbeiten ein transdisziplinäres Recherchesystem, in dem zukünftig die verstreut gelagerten Sammlungsobjekte unserer Universität digital aufgefunden und für die Forschung genutzt werden können.
Macht Mikroplastik krank?
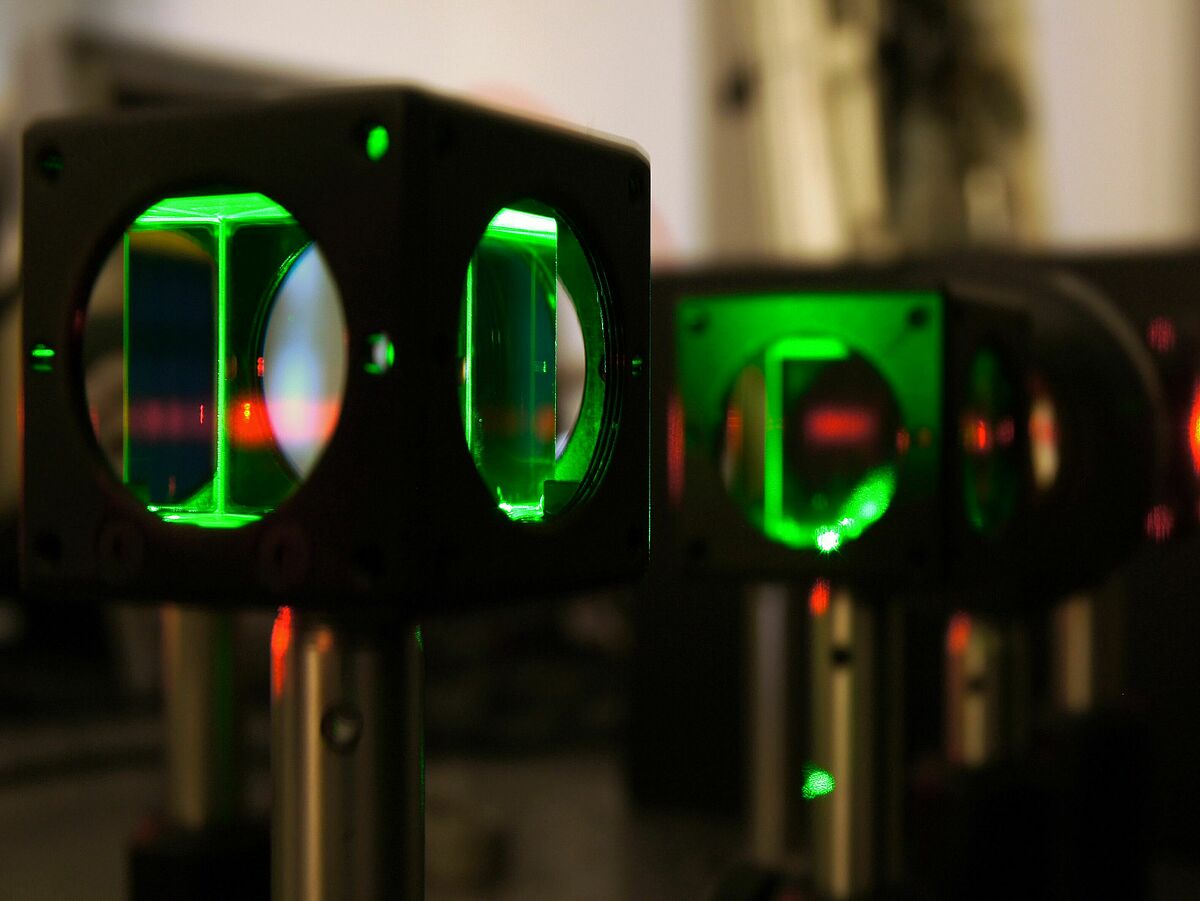
Mikroplastik sind kleinste Plastikteilchen. Für das bloße Auge sind sie meist unsichtbar. Doch sie sind überall: in den Tiefen des Meeres, im Trinkwasser und in der Luft. Für die weltweiten Ökosysteme stellt Mikroplastik eine ernst zu nehmende Bedrohung dar, deren voller Umfang noch nicht absehbar ist. Über die Nahrung gelangen sie auch in den menschlichen Körper.
Welchen Einfluss die kleinen Plastikpartikel auf den menschlichen Körper haben, ist weitgehend unklar. Der Grund dafür ist unter anderem, dass die winzigen Partikel in den komplexen Strukturen von Zellen und Geweben nicht ohne weiteres nachgewiesen werden können. Forschende aus der Physik, Biochemie und Biologie entwickeln im Projekt PlasMark neue physikalische Verfahren, um auch kleinste Kunststoffpartikel sichtbar zu machen und deren Ursprungsmaterial zu identifizieren.
„Wir kombinieren in unserem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt die Fähigkeiten und Expertisen mehrerer Arbeitsgruppen an verschiedenen Instituten“, beschreiben Prof. Mihaela Delcea, Prof. Markus Münzenberg und Dr. Oliver Otto den Beitrag der Universität Greifswald. Beispielsweise wurden am interdisziplinären Institut ZIK HIKE bereits Methoden entwickelt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mittels Biomechanik und Nanotechnologie zu erforschen. Das nun begonnene Projekt geht einen Schritt weiter. Mikroplastikpartikel sollen erstmals mittels modernster Terahertz-Spektroskopie direkt im menschlichen Gewebe bestimmt werden. Die zu untersuchenden Partikel werden dabei zunächst im Labor erzeugt, indem gewöhnliche Plastikflaschen mit sogenannten Mikroscheren zerschnitten werden. Mit den Analyseverfahren, die im Rahmen des Projekts entwickelt werden, wird dann die Wirkung von Mikroplastik auf menschliche Zellen in-vitro untersucht. Die Stärke dieses Verbundprojektes liegt in der Zusammenarbeit aller drei Partner, des ZIK plasmatis, des ZIK HIKE gemeinsam mit der Universität Greifswald sowie des ZIK innoFSPEC. Das Projekt ist zunächst für zwei Jahre ausgelegt. Ziel ist zu verstehen, inwiefern Mikroplastik mit dem Auftreten von Krankheiten assoziiert werden kann.
Weitere Informationen
Partner im Projekt PlasMark:
- ZIK plasmatis am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald (INP)
- ZIK HIKE an der Universitätsmedizin Greifswald und der Universität Greifswald
- ZIK innoFSPEC am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam (AIP)
Stehen Sekundarschüler*innen unter Stress?

Stress und Burnout in der Bevölkerung nehmen stetig zu. Stress ist mittlerweile eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen und das frühzeitige Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Anhaltender Stress schädigt unseren Organismus. Er belastet das Herz-Kreislauf-System und wirkt negativ auf den Gemütszustand und die Leistungsfähigkeit von Menschen. Erschreckenderweise berichten sogar jüngere Sekundarschüler*innen zunehmend von Schlafstörungen, Bauchweh, Schwindel und Müdigkeit. Sie fühlen sich den Anforderungen und möglichen Erwartungen aus Schule und Familie nicht gewachsen.
Aus der Stressforschung ist bekannt, dass Individuen Stressoren unterschiedlich bewerten und verarbeiten. Bei einigen Schüler*innen löst eine bevorstehende Unterrichtsstunde Stress aus. Schon beim Gedanken an Schule dreht sich ihnen der Magen um. Andere Schüler*innen freuen sich, in die Schule zu gehen, um dort Neues zu lernen und Herausforderungen zu begegnen. Bislang ist wenig darüber bekannt, wie individuelle und kontextuelle Bedingungen mit der Wahrnehmung von Stress und mit körperlichen Stressreaktionen von Schüler*innen zusammenhängen und welche Resilienzfaktoren dazu beitragen, dass Schüler*innen Herausforderungen meistern und sich in der Schule wohlfühlen.
Unter der Leitung von Dr. Frances Hoferichter untersucht eine interdisziplinär ausgerichtete Arbeitsgruppe am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Greifswald, inwiefern Eltern, Lehrer*innen und Mitschüler*innen dazu beitragen können, dass Sekundarschüler*innen aus Mecklenburg-Vorpommern weniger Stress empfinden und geringere körperliche Stressreaktionen zeigen. Dafür beantworteten 733 Schüler*innen der siebten und achten Klasse aus zwölf Regionalen Schulen und Gymnasien Fragen zur Qualität ihrer sozialen Beziehungen, ihrem Wohlbefinden, Stress und Schulburnout sowie zur Persönlichkeit und Resilienz.
Die Ergebnisse aus den Fragebögen wurden ergänzt durch Biomarkertests, an denen 83 zufällig ausgewählte Schüler*innen freiwillig teilnahmen. In den Tests wurden das Stresshormon-Niveau und der oxidative Stress ermittelt. Durch einen innovativen Zugang zum Thema und das komplexe Forschungsdesign kann ein vielschichtiges Bild über Stressmechanismen generiert und Empfehlungen für die Gestaltung des Unterrichts abgeleitet werden. Schüler*innen sollen damit beim Lernen und in ihrer Entwicklung effektiv unterstützt werden. Mit der Zusammenführung von biologischen Stressmarkern und Selbstberichtsdaten über individuelle und kontextuelle Faktoren, die das Stressempfinden und Wohlbefinden beeinflussen, ist die Studie an der Schnittstelle von Bildungswissenschaft, Psychologie und Biologie angesiedelt. Erste Ergebnisse zeigen, dass Schüler*innen weniger Stress empfinden sowie körperlichen Stress aufweisen, wenn sie sich von ihren Eltern und Lehrer*innen unterstützt fühlen, was gleichermaßen für Jungen und Mädchen sowohl unabhängig von der Schulform und soziökonomischem Status gilt. Weitere Ergebnisse zur Nutzung von sozialen Medien zeigen, dass Schüler*innen, die täglich in sozialen Medien aktiv sind, mehr körperlichen Stress aufweisen (connection overload) und das Bedürfnis, Bilder in sozialen Medien hochzuladen (approval anxiety), mit subjektivem Stresserleben einhergeht.
Fressen Enzyme unseren Plastikmüll?

Kunststoffe sind an sich wunderbare Materialien, weil sie extrem vielseitig einsetzbar und nahezu ewig haltbar sind. Doch genau dies ist auch der Grund für ein großes Umweltproblem. Nach rund 100 Jahren Kunststoffproduktion sind Plastikpartikel inzwischen überall: in den Ozeanen, im Grundwasser, in der Luft und in der Nahrungskette. Fressen können Enzyme unseren Plastikmüll nicht. Sie können Plastik aber immerhin in seine Bestandteile zerlegen. Dies gelingt bislang jedoch nur für Polyester wie PET, woraus beispielsweise Getränkeflaschen hergestellt werden. In der Tat gibt es ein Bakterium, das PET abbauen und die Bruchstücke als Nahrungsquelle verwenden kann. Ein japanisches Team hatte dieses Bakterium (Ideonella sakaiensis) im Jahr 2016 entdeckt und herausgefunden, dass es PET mit Hilfe von zwei Enzymen – PETase und MHETase – in seine Bausteine zerlegen kann. Dies geschieht allerdings sehr langsam. Diese Fähigkeit ist aus evolutionärer Sicht hochinteressant, da es diesen Kunststoff erst seit knapp 80 Jahren überhaupt auf der Erde gibt; ein sehr kurzer Zeitraum für die natürliche Evolution von Organismen. In der aktuellen Forschung ist es uns und anderen Arbeitsgruppen nun gelungen, PET-spaltende Enzyme aktiver zu machen. Ein französisches Team hat hierfür bereits ein integriertes Verfahren für das Recycling von PET entwickelt.
Doch was ist mit den vielen anderen Kunststoffen? Weltweit gibt es erhebliche Anstrengungen, die „Plastikkrise“ durch biotechnologische Methoden zu bewältigen. Der Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten widmen sich Forschende der Arbeitsgruppe Biotechnologie und Enzymkatalyse an der Universität Greifswald unter anderem in einem kürzlich in der Zeitschrift Nature Catalysis erschienenen Positionspapier. Gemeinsam erforschen sie in einem von der Europäischen Union im Rahmen von Horizon 2020 geförderten Verbundprojekt MIX-UP mit Forschenden aus China, wie eine Wertschöpfung aus Plastikabfällen, sowohl aus den Ozeanen als auch aus Haushalten, durch biotechnologische Verfahren erzielt werden kann. Wichtig ist, vor allem für langlebiges Plastik eine mittelfristige Lösung zu finden: Ein kontrollierter Abbau sollte innerhalb von wenigen Jahren – statt wie bisher in Hunderten von Jahren – sichergestellt sein. Für eine effiziente Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen schlägt das Team sechs Prinzipien vor, damit neu produzierte Kunststoffe unsere Umwelt nicht belasten: „überdenken – ablehnen – reduzieren – wiederverwenden – recyceln – ersetzen“.
Weitere Informationen
Video:
- Interview mit Prof. Dr. Uwe Bornscheuer zur „Molekularen Schere“
Literatur:
- Wei, R., Tiso, T., Bertling, J. et al. (2020): „Possibilities and limitations of biotechnological plastic degradation and recycling“, in: Nature Catalysis. https://www.nature.com/articles/s41929-020-00521-w
- Bornscheuer, U. (2020): „Behind the Paper: Possibilities and limitations of biotechnological plastic degradation and recycling”.
- Tournier, V. et al., An engineered PET depolymerase to break down and recycle plastic bottles, Nature 580, 216-219 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2149-4
- Palm, G.J. et al., Structure of the plastic-degrading I. sakaiensis MHETase bound to a substrate, Nature Commun., 10, 1717 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-09326-3
- Yoshida, S. et al., A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene) terephthalate, Science, 351, 1196-1199 (2016). https://doi.org/10.1126/science.aad6359
- Bornscheuer, U.T., Feeding on plastic, Science, 351, 1155-1156 (2016). https://doi.org/10.1126/science.aaf2853
Wahljahr in den USA – Warum Qualitätsjournalismus für eine Demokratie so wichtig ist

Am 3. November wird der 46. US-Präsident gewählt. Die Wahlen finden im Kontext einer tief gespaltenen Gesellschaft sowie einer gezielt irreführenden Nachrichtenlandschaft statt. Die US-amerikanische Politik spaltet sich im Wesentlichen in Republikaner (mehr oder weniger konservativ) und Demokraten (mehr oder weniger liberal). Auch die großen Nachrichtensender spalten sich in diese Lager. Auf der einen Seite steht der Sender Fox News, 1996 gegründet, der regierungstreu und auf Linie der Republikaner berichtet. Auf der anderen Seite gibt es regierungskritische Sender wie CNN und MSNBC.
Mit Blick auf die Presse und lokale Nachrichten sind in den USA ganze Landstriche zu „Nachrichtenwüsten“ geworden. Seit 2004 sind in den USA 1800 Tageszeitungen von der Bildfläche verschwunden. Die Hälfte aller US-Counties hat nur noch eine lokale Tageszeitung; oft ist es nur noch eine Wochenzeitschrift. Betroffen sind vor allem Regionen, in denen viele ärmere und weniger gebildete Menschen leben. Diese Leserschaft greift vor allem auf nicht redaktionell betreute Online-Medien zurück. Hier trifft sie auf eine Kultur der gezielten Desinformation.
Wie bereits 2016 werden die Wahlen von gezielten Falschmeldungen und online gestreuten Gerüchten über Politiker*innen und Parteien stark beeinflusst. Eine zentrale Rolle spielt Facebook: Facebook war und ist Verbreiter tausender Fake News. Gleichzeitig ist Facebook eine wichtige Informationsquelle für viele Amerikaner*innen. 67 Prozent der US-Amerikaner*innen nutzen Facebook; unter ihnen nutzen 46 Prozent Facebook für die Nachrichteninformation. Zudem informiert sich das Gros der Social-Media-Nutzer*innen lediglich in einem sozialen Netzwerk. Im Wahlkampf 2016 war der*die durchschnittliche US-Amerikaner*in mehr online Falschmeldungen pro Trump als pro Clinton ausgesetzt. Zu welchem Grad Online-Fake-News jedoch den Wahlausgang beeinflussten, bleibt unklar.
Der Erfolg von Fake News macht Schwachstellen und Gefahren auf verschiedenen Ebenen deutlich. Dazu gehören die Profitlogik von Medien, die Spaltung der Gesellschaft sowie politische Kräfte, die mehr oder weniger offen der Demokratie schaden wollen. Qualitätsjournalismus schwindet an vielen Stellen. Dieser ist jedoch von zentraler Bedeutung, um Fake News und die dahinterstehenden Interessen aufzudecken. Die Wahl am 3. November wird zeigen, wie sich die US-Amerikanische Gesellschaft positioniert.
Weitere Informationen
- Politische Spaltung der U.S.-amerikanischen Gesellschaft
- Unterschiede zwischen CNN sowie MSNBC und Fox News
- Folgen des Verschwindens von Tageszeitungen
- Rolle von Facebook für den Ausgang der Wahlen
- Social-Media als Informationsmittel
- Anteil der Falschmeldungen bezogen auf die Präsidentschaftskandidaten 2016
Ansprechpartnerin
Dr. Martha Kuhnhenn
Pneumokokken – Zwischen harmlosem Besiedler und gefährlichem Erreger

Pneumokokken können Infektionen wie Lüngenentzündungen auslösen
Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) sind einerseits harmlose Bakterien, die symptomlos die oberen Atemwege des Menschen besiedeln können. Träger sind vor allem Kinder, die die Bakterien durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Pneumokokken sind sehr anpassungsfähig. Sie finden die Schwäche ihres Wirtes und nutzen diese aus. Bei einem geschwächten Immunsystem können Pneumokokken schnell von einem harmlosen Besiedler zu einem gefährlichen Erreger werden und schwerwiegende Infektionen hervorrufen, wie eine Lungenentzündung (Pneumonie), die häufig einen schweren Verlauf nimmt und mit einer Blutvergiftung (Sepsis) einhergehen kann. Es wird oft vergessenen, dass eine Lungenentzündung für Kinder schnell tödlich enden kann. Auf der ganzen Welt sind Pneumokokken der bedeutendste Auslöser schwerer Pneumonien bei Kindern. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr mehr als 150 Millionen Lungenentzündungen bei Kleinkindern in Entwicklungsländern auftreten. Das macht mehr als 95 Prozent aller Fälle weltweit aus. Mehr als zwei Millionen Kinder sterben jährlich an dieser Krankheit. Darüber hinaus können Pneumokokken neben milderen Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen auch lebensbedrohliche Hirnhautentzündungen verursachen. Abgesehen von Kleinkindern sind zudem auch ältere und immungeschwächte Menschen einem erhöhten Risiko ausgesetzt.
Wie Virulenzfaktoren als Türöffner für den menschlichen Körper dienen können
Um sich im Wirt durchzusetzen, produzieren die Pneumokokken Zuckerstrukturen und Proteine, so genannte Virulenzfaktoren, die den Wirt schädigen können, das Immunsystem des Wirts manipulieren oder auch ausnutzen. Virulenzfaktoren dienen den Pneumokokken beispielsweise dazu, sich an Zellen im Nasenrachenraum oder der Lunge des Menschen anzuheften und in tieferes Gewebe einzudringen. Andere Virulenzfaktoren vermeiden Abwehrmechanismen oder verhindern, dass das Immunsystem des Wirts reagieren kann. Dadurch können die Bakterien im Menschen überleben. Einer der wichtigsten Virulenzfaktoren ist das Kapselpolysaccharid, eine variable Zuckerstruktur, die die Pneumokokken ummantelt und sie so davor schützt, von Fresszellen erkannt und beseitigt zu werden. Pneumokokken produzieren zudem ein Toxin, das Pneumolysin. Es wird freigesetzt, wenn Pneumokokken im Wirt absterben. Freigesetztes Pneumolysin bindet an die Membran von Wirtszellen und bildet dort Poren. Dadurch sterben die Wirtszellen ab und die Barrieren oder die Abwehrzellen werden geschädigt.
Worauf Schutzimpfungen gegen Pneumokokken basieren
Basierend auf den Kapselpolysacchariden werden Pneumokokken in Serotypen eingeteilt, von denen bis heute über 95 bekannt sind. Diese Kapselpolysaccharide bilden auch die Grundlage für die derzeitig verfügbaren Impfstoffe. Die Pneumokokken-Impfung wird als Standardimpfung für alle Säuglinge und Kleinkinder sowie für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Zukünftig werden jedoch neue Impfstoffe benötigt, da die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe auf die von ihnen abgedeckten Serotypen beschränkt ist. Derzeit bieten Pneumokokken-Impfstoffe demnach gegen maximal 23 Serotypen einen Schutz.
Was die Pneumokokken-Forschung im Visier hat
Forschende der Universität Greifswald untersuchen unter Ausnutzung verschiedener Infektionsmodelle die Wirt-Erreger-Interaktionen der Pneumokokken, um die Mechanismen zu verstehen, die für eine erfolgreiche Besiedlung des Nasenrachenraumes und die Umwandlung in ein aggressives Bakterium notwendig sind. Dazu werden bakterielle Virulenzfaktoren identifiziert und ihre Funktion sowie Struktur aufgeklärt, die eine Kolonisierung und das Durchbrechen der Lungenbarriere ermöglichen. Auf der anderen Seite gehen die Forscher*innen den Mechanismen auf den Grund, welche es den Pneumokokken ermöglichen, der Immunabwehr durch den Menschen zu entkommen. Weitere Forschungsprojekte zielen darauf ab, neue Impfstoffkandidaten zu finden, die eine Basis für einen Serotyp-unabhängigen Impfstoff bilden sollen.
Weitere Informationen
- Interfakultäres Institut für Genetik und Funktionelle Genomforschung (C_FunGene) der Universität Greifswald
- Abteilung für Molekulare Genetik und Infektionsbiologie (MNF)
- Graduiertenkolleg: Bakterielle Atemwegserkrankungen (GRK 1870)
- Aufklärung der Pathomechanismen bakto-viraler Koinfektionen mit neuen biomedizinischen Modellen (KoInfekt)
- Entwicklung von Impfstoffen gegen respiratorische und systemische Infektionen (VacoME)
- Das Zusammenspiel zwischen Blutplättchen und pathogenen Bakterien
Ansprechpartner*innen
Prof. Dr. Sven Hammerschmidt
Dr. Franziska Voß
Was der winterliche Schrumpel-Apfel besser kann als importiertes Obst

Am Institut für Botanik und Landschaftsökologie gibt es eine seltene Sammlung von Obstmodellen: das „Arnoldische Obst-Cabinet“. Die Äpfel, Birnen oder Pfirsiche sehen täuschend echt aus. Die Modelle wurden zwischen 1856 und 1899 von Heinrich Arnoldi (1813–1885) aus einer speziellen Gipsmasse gegossen und anschließend aufwändig gestaltet. Arnoldi verkaufte seine Früchte zusammen mit detailreichen Beschreibungen an Obstbauern und als Lehrmittel an wissenschaftliche Institute – darunter die Universität Greifswald. Aber auch Liebhaber kauften die täuschend echten Früchte und stellten sie sich als Dekorationsobjekte in ihre Wohnungen.
Arnoldis Cabinet gilt heute als eines der sortenreichsten und schönsten Obstkabinette. Die Greifswalder Sammlung umfasst noch 214 von insgesamt 455 Modellen aus der Arnoldischen Manufaktur, darunter 104 Äpfel, 73 Birnen und einige andere Obstsorten. Ein Teil der Sammlung wird derzeit im Humboldt Forum in Berlin ausgestellt.
Die Modelle zeigen uns heute, welche Obstsorten im 18. und 19. Jahrhundert im mitteleuropäischen Raum angebaut wurden. Sie führen uns vor Augen, wie vielfältig die heimische Sortenvielfalt sein könnte. In unseren Supermärkten wird – einschließlich der Importware – nur ein Bruchteil dieser Obstsorten angeboten. Zu Arnoldis Zeiten gab es beispielsweise Äpfel für jeden Zweck und für jede Jahreszeit. Es gab Äpfel zum Backen, zum Entsaften und für das Dessert. Es gab Sorten für den Sommer, den Herbst und den Winter. Einige Apfelsorten wurden im Herbst geerntet, mussten aber noch reifen und waren erst zu Weihnachten oder im Januar genießbar.
Der Obstanbau war zu Arnoldis Zeiten nicht nur geprägt von großer Sortenvielfalt. Obst wurde damals auf Streuobstwiesen angepflanzt und geerntet. Denn fast alle Obstbäume müssen fremdbestäubt werden. Es braucht also einen zweiten Baum in der Nähe und die Hilfe von Bienen. Streuobstwiesen tragen auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Mit der Modernisierung des Obstanbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele dieser Streuostwiesen gerodet.
Die Modelle sind heute ein Forschungsobjekt in der Pomologie, der Lehre von den Obstsorten. Die Pomologie entwickelte sich im 18. Jahrhundert und war im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Heute lebt das Interesse an den alten Obstsorten wieder auf. Denn alte Obstsorten haben viel zu bieten: Sie sind vielfältiger, sie schmecken oft besser und sind dazu oft haltbarer. Außerdem können sie regional erzeugt und vertrieben werden. Das wiederum ist gut für die CO2-Bilanz und das Klima. Angesichts des Klimawandels ist die Sammlung heute auch wieder für die Landwirtschaft relevant. Denn alte Sorten sind teils besser für den Klimawandel gerüstet als die empfindlichen Supermarkt-Sorten. In Zukunft könnte der winterliche Schrumpel-Apfel wieder eine ernsthafte Alternative zu importiertem Obst vom anderen Ende der Welt sein.
Wie Gletscher die Rügener Kreideküste formten

Die Rügener Schreibkreide entstand vor etwa 70 Millionen Jahren als Meeresablagerung. Vor weniger als 20 000 Jahren, in der Weichsel-Kaltzeit, wurden diese Ablagerungen großräumig vom Eis verformt. Denn Rügen lag während der Weichselvereisung im Randbereich des Skandinavischen Inlandeises. Das Eis ist im Laufe der Kaltzeit mehrmals angewachsen und zurückgeschmolzen. In dem Gebiet der heutigen Rügener Kreideküste hat es mindestens zwei heftige Gletschervorstöße gegeben. Die Gletscher haben die Kreide in einer Tiefe von rund 100 Meter abgeschert und herausgehoben. Dabei wurde die Kreide gefaltet und in Schuppen zerlegt. Die Schuppen wurden vor dem Gletscher dachziegelartig übereinander geschoben.
Die Oberflächenformen der Halbinsel Jasmund im Nordosten der Insel Rügen und komplizierte innere Strukturen der Kreide geben Aufschluss über die einzelnen Gletschervorstöße. Die Verformungsprozesse können mit Hilfe von Rechenmodellen am Computer schrittweise aufgedeckt werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass zuerst der nördliche Teil Jasmunds durch einen Gletschervorstoß aus Nordosten gebildet wurde. Danach entstand der südliche Teil Jasmunds durch einen lokalen Eisschub aus südlicher Richtung. Die höchste Erhebung an der Küste, der Königsstuhl (118 Meter über NN), stellt einen Grenzbereich zwischen dem glazitektonischen Nord- und Südteil der Halbinsel dar.
Das Ergebnis der gewaltigen Verformungen können Interessierte heute selbst beobachten, wenn sie die Kreideküste im Osten und Norden von Jasmund besuchen. Das weiße Lockergestein enthält dunkle Feuersteinlagen, die ursprünglich horizontal abgelagert wurden, heute jedoch unterschiedlich stark geneigt und gefaltet sind. Außerdem treten regelmäßig Abschnitte auf, die braun, grau und ocker gefärbte Ablagerungen aus Geschiebemergel, Ton, Sand oder Kies enthalten. Diese jüngeren Ablagerungen aus den vorherigen Eisvorstößen markieren immer das hintere Ende einer Schuppe und die Nähe zu einer weiteren Überschiebungsbahn.
Das neu entwickelte Entstehungsmodell der Halbinsel Jasmund zeigt, dass die Rügener Schreibkreide zwischen Sassnitz und dem Königsstuhl durch die Kraft eines Gletschers um die Hälfte von elf auf etwa 5,5 Kilometer zusammengeschoben wurde. Ursprünglich lag die Kreide, die wir heute an der Küste sehen können, weiter südöstlich in der Prorer Wiek.
Weitere Informationen
Literatur
- Dissertation von Dr. Anna Gehrmann: „The multi-stage structural development of the Upper Weichselian Jasmund Glacitectonic Complex, Rügen, NE Germany“
- Gehrmann, A., Meschede, M., Hüneke, H., Pedersen, S. A. S. (2019): Sea cliff at Kieler Ufer (Pleistocene stripes 11–16) – large-scale architecture and kinematics of the Jasmund Glacitectonic Complex. – DEUQUA Special Publications, 2: 19-27. DOI: 10.5194/deuquasp-2-19-2019
- Gehrmann, A. & Harding, C. (2018): Geomorphological Mapping and Spatial Analyses of an Upper Weichselian Glacitectonic Complex based on LiDAR Data, Jasmund Peninsula (NE Rügen), Germany. – Geosciences, 8(6), 208. DOI: 10.3390/geosciences8060208
Zucker aus dem Meer
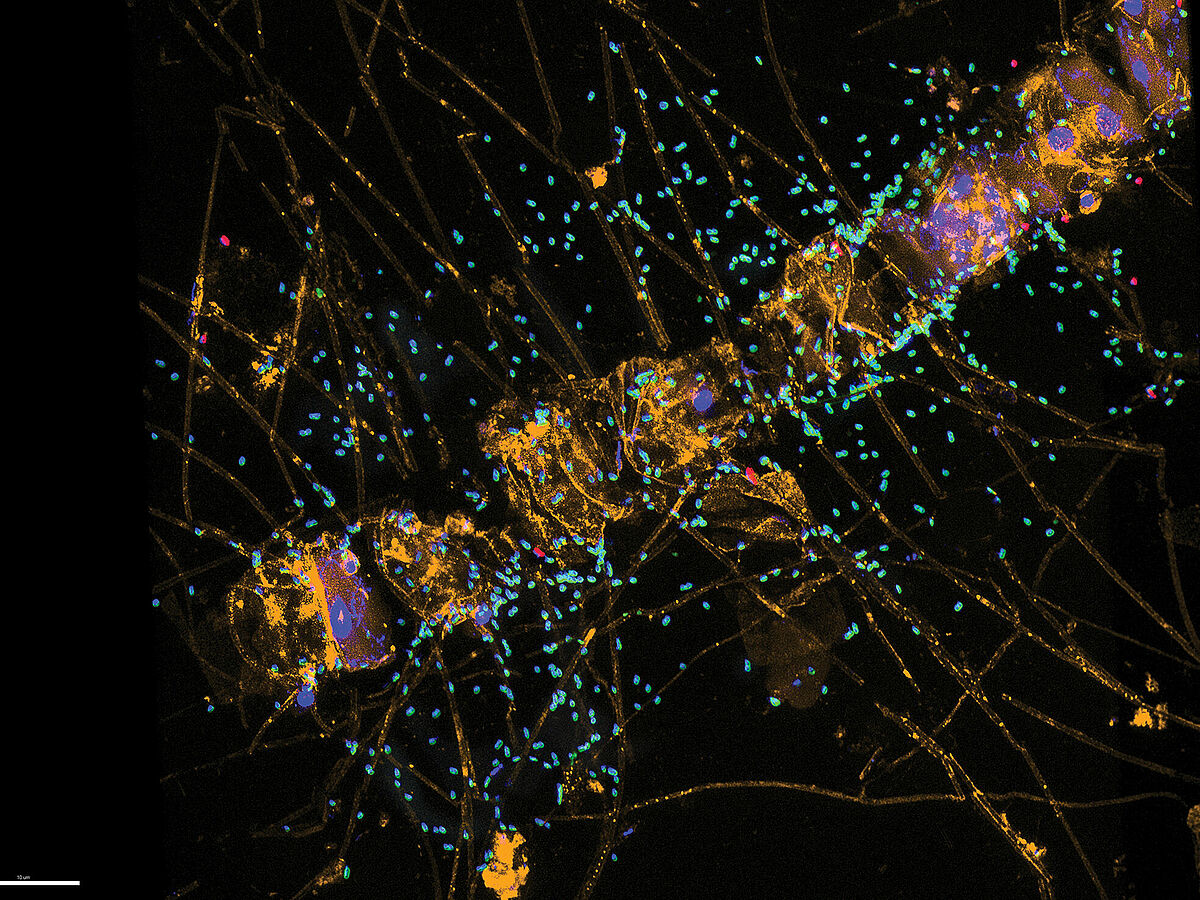
Mehrfachzucker, auch Polysaccharide genannt, sind die chemisch komplexesten Makromoleküle in der Natur. Sie bestehen aus verschieden verknüpften Zuckermolekülen, die mit einer Vielzahl weiterer funktioneller Gruppen verwoben sind. Meeresalgen produzieren viele verschiedene Arten dieser komplexen Zuckerverbindungen. Algenbiomasse kann zu mehr als 50 Prozent aus Mehrfachzuckern bestehen. Damit der Zucker aus Algen in Zukunft biotechnologisch genutzt werden kann, müssen neue enzymatische Verfahren geschaffen werden. Die Werkzeuge für diese Verfahren liefern Zucker abbauende marine Bakterien, die während Algenblüten im Meerwasser in hoher Zahl zu finden sind. Marine Bakterien, die auf die Zersetzung von Algenzuckern spezialisiert sind, weisen eine bemerkenswerte Vielfalt an kohlenhydrataktiven Enzymen auf. Diese Enzyme sind nötig, damit Bakterien im Team die komplexen Algenzucker verwerten können. Diese Abbauwege werden durch aufeinander abgestimmte Enzymkaskaden vermittelt, an denen an der Universität Greifswald mit Partnern in Bremen im Rahmen der Forschungsgruppe POMPU (FOR 2406) sowie im Rahmen der BMBF Initiativen Plant3 sowie BaMS gearbeitet wird.
Weiterführende Literatur
- Artikel „Zucker aus dem Meer“ im Campus 1456 Magazin der Uni Greifswald, Nr. 13/April 2020, S. 12
- Reisky L, Préchoux A, Zühlke MK et al. (2019): A marine bacterial enzymatic cascade degrades the algal polysaccharide ulvan. in Nat Chem Biol., 15: 803–812.
- Sichert A, Corzett CH, Schechter MS et al. (2020): Verrucomicrobia use hundreds of enzymes to digest the algal polysaccharide fucoidan. in Nat Microbiol., 5: 1026-1039.
Wie die alten Finnen auf die Erbse kamen – Sprachhistorische Evidenz als wichtige Quelle vorhistorischer Kulturentwicklung

Zur Beurteilung früher Kulturkontakte im Ostseeraum nimmt die Sprachwissenschaft häufig eine Schlüsselrolle ein, denn im Wortschatz einer Sprache spiegeln sich jene Wege wider, auf denen ihre Sprecher*innen vor Jahrtausenden mit kulturellen Innovationen in Kontakt kamen. Der etymologischen Entschlüsselung dieser Spuren widmet sich die Lehnwortforschung als eine hochkomplexe linguistische Disziplin, die gerade in nördlichen Gefilden selbst der Archäologie einen Schritt voraus sein kann. Linguistisch galt es so seit geraumer Zeit als gesichert, dass die Urahnen der Esten und Finnen die Erbse als Kulturpflanze bei ackerbauenden baltischen Stämmen an der Südküste des Finnischen Meerbusens kennengelernt hatten. Permanenten Zweifel daran meldete jedoch aus klimatischen Erwägungen lange die Archäologie an, bis schließlich neuere Ausgrabungen in Litauen den Anbau der Hülsenfrüchte seit der Übergangsphase von der Bronze- zur Eisenzeit sicher belegten. Die lautlichen und zeitlichen Rekonstruktionen der Linguisten hatten also bereits viel früher gezeigt, dass die heutigen ostseefinnischen Wörter für Erbse (finnisch herne, estnisch hernes) sicher auf ein urbaltisches Wort zurückgehen, das sich im heutigen Litauischen als žirnis präsentiert. Mit der Bewertung und Systematisierung hunderter ähnlicher Fälle beschäftigt sich das Forschungsprojekt Baltische und ostseefinnische Sprachen im vorhistorischen Kontakt am Lehrstuhl für Fennistik.
Die sprachliche Ausbildung an der Greifswalder Fennistik widmet sich jedoch weniger der vorhistorischen „Erbsenzählerei“ als vielmehr der Vermittlung der modernen Sprachen und Kulturen Finnlands und Estlands. Am ältesten Finnischlektorat des deutschsprachigen Raums und am einzigem Gastlektorat für Estnisch gibt es beste Voraussetzungen für alle Studieninteressierten.
Weitere Informationen: Interview mit dem Projektleiter Dr. Santeri Junttila
Die wahren Kosten von Lebensmitteln

Was kosten uns Lebensmittel wirklich? Mit dieser Frage ist nicht nur der Preis gemeint, den wir als Verbraucher im Supermarkt zahlen müssen. Bei Lebensmitteln lassen sich auch ökologische und soziale Folgekosten berechnen: Die sogenannten wahren Kosten (True Costs). Das sind Kosten die z. B. bei der Aufbereitung von Wasserverschmutzung, Schadstoffausstoß durch Futterproduktion oder Beheizung von Ställen entstehen und von der gesamten Gesellschaft ausgeglichen werden müssen.
Forschende der Universität Greifswald und der Universität Augsburg haben diese Kosten in einem Praxisprojekt mit der PENNY Markt GmbH untersucht. Für die Berechnung bekommen die Faktoren der Treibhausgasemissionen, der reaktiven Stickstoffemissionen, des Energieverbrauchs und der Landnutzungsänderungen, verursacht durch biologische und konventionelle Lebensmittelerzeugung, einen Preis. Die Untersuchungen zeigen teilweise sehr große Preisunterschiede zwischen den aktuellen Marktpreisen und den wahren Kosten, vor allem bei tierischen Lebensmitteln, die auf herkömmliche Weise produziert wurden.
Konventionelles Fleisch müsste inklusive der wahren Kosten eigentlich bis zu 173 % teurer sein. Bio-Fleisch würde mit den versteckten Kosten immerhin auch noch 126 % mehr kosten. Pflanzliche Lebensmittel schneiden relativ gut ab, hier ist die Bepreisung schon relativ sinnvoll und nah an den wahren Kosten. Die hohen Kosten für tierische Produkte kommen vor allem durch die ressourcenintensive Aufzucht und die Fütterung der Tiere, sowie durch Emissionen bei der Verdauung der Tiere zustande. Konventionelle und Bioprodukte unterscheiden sich vor allem durch künstlichen Stickstoffdünger und importierte Futtermittel, welche in der Bioproduktion nicht oder nur eingeschränkt zugelassen sind und sich stark auf die Ökobilanz auswirken.
Die Forscher*innen erhoffen sich aus dem Praxisprojekt mit PENNY und den weiteren Forschungen die gesellschaftliche Diskussion voranzutreiben und auch mit politischen Entscheidungsträger*innen über mögliche Maßnahmen der Internalisierung ökologischer Folgekosten zu diskutieren.
Medieninformation
Projekthintergrund
Podcast zum Thema vom Handelsblatt
Wird auf Instagram einfach alles geliket?
Wovon hängt eigentlich ab, was man auf Instagram, Twitter oder YouTube liket? Natürlich spielt eine Rolle, was einem gut gefällt. Es gibt aber auch strukturelle Einflüsse: Um einen Post liken zu können, muss er sichtbar sein. Und umso öfter er gelikt wird, umso sichtbarer wird er, dafür sorgen die Empfehlungssysteme der Plattformen. Umso sichtbarer ein Post wird, umso mehr Likes bekommt er wiederum. Dieser Verstärkungsprozess ist ein ganz zentraler Mechanismus bei der Entwicklung von sozialen Netzwerken, im Internet aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Wer hat, dem wird gegeben. In sozialen Netzwerken wird dieser Mechanismus Preferential Attachment genannt.
Normalerweise gehen wir deshalb davon aus, dass die meisten Posts sehr wenige Likes bekommen und nur sehr wenige Posts ganz viele Likes bekommen – es entsteht eine schiefe Pareto-Verteilung wie man sie in der Grafik bei Twitter oder YouTube erkennt. Die Daten kommen aus dem LIKE-Projekt und enthalten alle Posts von deutschen Nachrichtenseiten im letzten Winter. Um die Verteilung der Likes besser sichtbar zu machen, sind die Achsen logarithmisch skaliert. Zum Beispiel haben auf Twitter über 100 000 Tweets kein Like und nur knapp 50 Tweets bekommen über 1000 Likes. Insgesamt sind in der Stichprobe über 270 000 Tweets enthalten.
Eine der Grafiken stellt uns (noch) vor ein Rätsel: Bei Instagram gibt es kaum Posts ohne Likes, was der Verteilungsannahme widerspricht.
Torfmoose tragen zum Klimaschutz bei

In Deutschland sind alle Torfmoose nach der Bundesartenschutzverordnung geschützt. Weltweit gibt es rund 300 Arten. Torfmoose sind vor allem in Hochmooren anzutreffen. Alle lebensnotwendigen Stoffe entziehen sie dem nährstoffarmen Substrat durch Ionenaustausch.
Torfmoose sorgen dafür, dass Moore nicht austrocknen, denn sie können ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser speichern. Damit tragen Sie auch zum Klimaschutz bei. Schließlich binden intakte Moore viel CO2.
Sterben die Pflanzen ab, so entsteht Torf, welcher manchmal handelsüblicher Blumenerde beigemischt ist. Im Handel gibt es jedoch auch sehr gute Torfersatzstoffe. Für den Garten haben sich Kokos- und Holzfasern bewährt, für Topfkulturen ist Nadelerde eine bessere Alternative, und im Freiland kann Schälrinde verwendet werden.
Mehr Informationen über Torfmoose sowie über 22 weitere Moosarten gibt es auf dem kürzlich eröffneten Lehrpfad „Ohne Moos nichts los“ im Botanischen Garten der Universität Greifswald. Zum Botanischen Garten
Woran erinnert der Gedenkstein im Ostseebad Boltenhagen?
Links vor der Seebrücke in Boltenhagen erinnert eine auf einem Findling angebrachte Plakette an Geschichten aus der DDR-Zeit, deren Dramatik sich heute kaum mehr erahnen lässt. Auf dem Gedenkstein, der im Jahr 2000 auf Initiative einer Bürgerin aus Dahme enthüllt wurde, steht: „Über der Ostsee leuchtete für uns das Licht der Freiheit! Den DDR-Flüchtlingen 1961–1989“.
Das mecklenburgische Boltenhagen und das schleswig-holsteinische Dahme verbindet eine gemeinsame Geschichte: Einige freiheitssuchende Menschen aus der DDR wählten die Route über das Meer, wobei ihnen der Leuchtturm von Dahmeshöved den Weg wies. Diese Orientierungsmarke für die DDR-Flüchtlinge erhielt daher den Beinamen „Licht der Freiheit“. Etwa 30 km Luftlinie lagen zwischen Boltenhagen und Dahme. Viele Fluchtversuche endeten mit dem Tod, weil die Strömungsverhältnisse zu unberechenbar waren, das Wasser zu kalt war oder die Kraft der Schwimmenden am Ende nachließ. Doch immer wieder sind Fluchten auch geglückt, wie die von Erhard Schelter, der seinen Kompagnon im September 1974 stundenlang bewusstlos hinter sich herzog, bis beide von einer Fähre in der Lübecker Bucht aufgenommen wurden.
Weitere Informationen
- Website des Verbundprojektes Ostseefluchten
- Artikel „Forschungsprojekt untersucht Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee“ im Campus 1456 Magazin der Uni Greifswald, Nr. 13/April 2020, S. 14/15
- Artikel „Wer sind die Toten aus der Ostsee?“ von Michael Meyer in der Ostsee-Zeitung vom 29.07.2020, Magazin, S. 1.
- Rätzke, Dorian: Zwischen Stacheldraht und Strandkorb. DDR-Alltag an der Lübecker Bucht. 3., akt. und erw. Auflage, Boltenhagen 2014. Maltzahn, Dietrich von: Querlage. Meine Erlebnisse als Arzt in Ost und West. Boltenhagen 2013. Müller, Christine/Müller, Bodo: Über die Ostsee in die Freiheit. Dramatische Fluchtgeschichten. Bielefeld 1992.
Dinosaurier Irritator challengeri ernährte sich vorwiegend von kleinen Beutetieren
Spinosaurier waren riesige fisch- und fleischfressende Dinosaurier, die vor allem an ihrer verlängerten Schnauze, kräftigen Vordergliedmaßen und teils verlängerten Fortsätzen von Wirbeln erkennbar sind. Unter den aus der Kreidezeit stammenden Fossilien der Spinosaurier stellen Schädelfunde eine Seltenheit dar. Ein Forscherteam, zu dem auch der Greifswalder Paläontologe Marco Schade gehört, hatte jedoch die Möglichkeit einen aus Brasilien stammenden und fast vollständig erhaltenen Schädel inklusive Gehirnkapsel des Irritator challengeri zu untersuchen. Mithilfe von sog. CT-Scannern konnten durch Schicht für Schicht erstellte Röntgenbilder neue Einblicke in den Aufbau von Gehirn und Innenohr des ausgestorbenen Riesen gewonnen werden. Diese Einblicke verraten einiges über die Lebensweise und Futtervorlieben von Irritator challengeri, unter anderem auch, wie gut er an vorherrschende Umwelteinflüsse angepasst war, wie gut er hören konnte und welche Beute er jagte. Die Analysen des Schädels bestätigen, dass sich das Tier vorwiegend von kleinen Beutetieren wie Fischen ernährte. Die Ergebnisse der Studie sind in Scientific Reports (doi: 10.1038/s41598-020-66261-w) erschienen und stehen Interessierten als Open Access zur Verfügung.
Info: In unserer nächsten Ausgabe von Campus 1456 erscheint zu diesem Thema ein Artikel in der Rubrik „Forschung“. Der Veröffentlichungstermin liegt im Oktober 2020.
Fledermäuse füttern fleischfressende Kannenpflanzen mit ihrem Kot
Dr. Caroline Schöner und Dr. Michael Schöner aus der Arbeitsgruppe Angewandte Zoologie und Naturschutz staunten nicht schlecht, als sie zum ersten Mal auf Borneo eine Wollfledermaus in einer fleischfressenden Kannenpflanze fanden. Das Tier erfreute sich bester Gesundheit und stand offensichtlich nicht auf dem Speiseplan einer Pflanzengattung, deren Vertreter sich eigentlich von Insekten ernähren, um Nähstoffmängel auszugleichen. Was hatte dies zu bedeuten? In einer Reihe von Studien konnten die beiden Wissenschaftler zeigen, dass die Pflanzen den Fledermäusen komfortable Quartiere bieten mit einem stabilen Mikroklima, ohne Parasiten oder Konkurrenz durch andere Fledermausarten. Damit die Fledermäuse auf sie aufmerksam werden, haben die Pflanzen eine Struktur entwickelt, die die Echoortungsrufe der Tiere laut reflektiert. Als „Miete“ hinterlassen die Fledermäuse, während sie in den Kannen schlafen, ihren Kot – ein nitratreicher Dünger, von dem die Kannenpflanzen sogar besser profitieren als von Insekten.
Weiterführende Literatur
- Grafe, T. U., C. R. Schöner, A. Junaidi, G. Kerth & M. G. Schöner (2011): A novel resource-service mutualism between bats and pitcher plants. Biology Letters 7: 436-439.
- Schöner, C. R., M. G. Schöner, G. Kerth & T. U. Grafe (2013): Supply determines demand: Influence of partner quality and quantity on the interactions between bats and pitcher plants. Oecologia 173: 191-202x.
- Schöner, M. G., C. R. Schöner, R. Simon, T. U. Grafe, S. J. Puechmaille, L. L. Ji & G. Kerth (2015): Bats are acoustically attracted to mutualistic carnivorous plants. Current Biology 25: 1-6. - Schöner, C.R., Schöner, M.G., Grafe, T.U., Clarke, C.M., Dombrowski, L., Tan, M.C. & Kerth, G. (2017): Ecological outsourcing: a pitcher plant benefits from transferring pre-digestion of prey to a bat mutualist. Journal of Ecology 105: 400-411.
Braune Witwenspinne mit kannibalistischem Paarungsverhalten

Normalerweise paaren sich Tiere, wenn sie erwachsen sind. Die meisten wirbellosen Tiere, wie zum Beispiel Spinnen, durchlaufen mehrere Häutungen. Dabei wachsen sie. Ab einer bestimmten Häutungsanzahl sind die Geschlechtsorgane innerlich und äußerlich herangereift. Erst ab dann sind Paarungen möglich. Bei der Braunen Witwenspinne Latrodectus geometricus enden Paarungen zwischen Weibchen und Männchen unweigerlich mit dem Tod des Männchens. Ein Männchen hat daher normalerweise nur einmal in seinem Leben die Chance zu einer Paarung.
Die Männchen überleben die Paarung jedoch, wenn sie sich mit einem noch nicht erwachsenen Weibchen paaren: Paarungen mit Weibchen, die wenige Tage vor ihrer Reifehäutung stehen, töten ihre Paarunsgpartner nicht. Die Männchen beißen mit ihren Kieferklauen die Körperdecke subadulter Weibchen in der Genitalregion auf und können so in die darunterliegenden, schon entwickelten Genitalstrukturen des Weibchens Spermien übertragen.
Dr. Lenka Sentenská und Prof. Dr. Yael Lubin haben zusammen mit Prof. Dr. Gabriele Uhl untersucht, ob die Männchen dieser Art eine Präferenz für risikofreie Paarungen mit subadulten Weibchen haben. In kontrollierten Wahlversuchen stellte sich heraus, dass Männchen – ungeachtet des tödlichen Ausgangs – immer erwachsene Weibchen ansteuern, und nicht die subadulten. Daraus ergibt sich, dass adulte Weibchen Fernlockstoffe einsetzen, subadulte dagegen nicht. Dies deutet darauf hin, dass in der Natur den subadulten Weibchen Nachteile durch die frühen Verpaarungen entstehen– diese für die Männchen aber von Vorteil sind.
Studie
Allgemeine und Systematische Zoologie
Zoologisches Institut und Museum
Der „Priming-Effekt“ als wichtiger Faktor bei der Freisetzung von Kohlenstoff aus Permafrost
Permafrost ist dauerhaft gefrorener Boden, der mehr Kohlenstoff speichert, als alle Pflanzen auf der Erde und die Atmosphäre zusammen. Taut der Permafrost in der Arktis, könnten immense Mengen an Kohlenstoff freigesetzt werden. Wie viel genau kann von Forschenden in Klimamodellen berechnet werden. Erstmals hat ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der AG Experimentelle Pflanzenökologie der Universität Greifswald bei diesen Berechnungen den sognannten „Priming-Effekt“ mit einbezogen. Dieser Effekt findet zwischen Pflanzen und Mikroben statt. Er tritt auf, wenn im Sommer der Permafrost auftaut. Die darin wurzelnden Pflanzen erwachen zum Leben und geben Kohlenstoff an die Mikroorganismen im Boden ab, was diesen ermöglicht mehr Humus zu zersetzen.
Durch die Studie konnten erstmals Auswirkungen des „Priming-Effekts“ auf die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre nachgewiesen werden. Die Interaktion kleinster Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln kann somit eine globale Wirkung haben. Allein durch diesen Effekt könnten bis zum Jahr 2100 zusätzlich 40 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangen.
Trockenheit der vergangenen Sommer erlaubt Ausblick auf die Zukunft des Waldes
Die Sommer in den Jahren 2018 und 2019 waren extrem warm und trocken. Doch welche Prognosen können vor diesem Hintergrund auf das Baumwachstum der regionalen Wälder gemacht werden? Um das herauszufinden, haben Wissenschaftler der Arbeitsgruppe Landschaftsökologie und Ökosystemdynamik am Institut für Botanik und Landschaftsökologie in einer Studie untersucht, wie sich das Dickenwachstum verschiedener typischer Laubbaumarten des Norddeutschen Tieflandes wie Buche, Eiche, Ahorn und Hainbuche entwickelt. Interessant ist, dass sich das Baumwachstum in beiden Jahren signifikant unterscheidet. 2018 konnten alle Baumarten von den sehr feuchten Winterbedingungen profitieren und zeigten in Norddeutschland trotz Rekordtemperaturen und Trockenheit im Sommer ein überdurchschnittliches Wachstum. Ganz anders 2019. Hier waren schon im Frühjahr die Bodenwasserspeicher leer, Buche und Hainbuche reagierten mit Wachstumseinbrüchen von bis zu 70 Prozent. Bergahorn und Eiche waren zwar nicht so stark betroffen, doch auch hier lag das Wachstum deutlich unter dem Durchschnittswert der vorhergehenden Jahre. Im Vergleich mit den Klimadaten der vergangenen 100 Jahre waren die Sommer 2018 und 2019 extrem. Laut den Klimaprognosen werden solche Sommer zum Ende des 21. Jahrhunderts jedoch eher die Normalität sein.
Zur Medieninformation
Zur Studie (Open Access)
„Camels and Cadillacs“ – Erfolgreiche Fotomotive bestimmen den Blick durch den Sucher

Zwischen Aleppo und Alexandria liebten Reisende ein Fotomotiv besonders – Kamel trifft Auto. Dies fand das Projekt „Das gelobte Land der Moderne“ heraus, mit dem das Gustaf-Dalman-Institut der Universität Greifswald rund 50.000 deutsche Reisebilder aus rund 100 Jahren analysiert hat. Einige Motive finden sich in der Kulturlandschaft Palästina über Jahrzehnte hinweg: Urlauber treiben mit der Zeitung in den Händen auf dem Toten Meer, Touristen versammeln sich auf Kamelen zum Gruppenfoto vor den Pyramiden von Gizeh.
Im Juli 1987 fotografiert der Judaist Gil Hüttenmeister vor der Cheops-Pyramide von Gizeh nicht nur das typische Kamel, sondern auch äußerst modernere Gefährte. Im Mittelgrund stehen zwei Ägypter bei ihrem sandfarbenen Pickup, der sich nahtlos in seine Umgebung einfügt. Im Vordergrund beraten sich Touristen vor einem leuchtorangen VW-Bus. Dieser Bulli bringt die Familie Hüttenmeister mehrfach zuverlässig von Tübingen über den Landweg und via Fähre bis in die Kulturlandschaft Palästina (und zurück). Vor der Pyramide macht er sich aber etwas fremd aus, so zumindest könnte es das Kamel sehen, das von links skeptisch auf den Eindringling blickt. Schon um 1900 fotografierten Reisende gerne das Kamel neben dem „Dampfross“, später waren es „Camels and Cadillacs“. Spätestens in den 1960er Jahre kippte dabei das Kräfteverhältnis vor Ort zugunsten der Automobile. Was blieb, war das Bild vom „alten Orient“ in den Köpfen der westliche Besucher. So gehört das Gegensatzpaar „Kamel trifft Auto“ bis heute zu den beliebtesten touristischen Fotomotiven.
Bis zum 13. Oktober 2020 werden ausgewählte Reisefotografien analog im Rostocker Max-Samuel-Haus ausgestellt – und zeitlich unbefristet virtuell:
www.uni-greiswald.de/das-gelobte-land
Kurz-Interview „3 Fragen, 3 Antworten“ mit Dr. Karin Berkemann zum Projekt
Menschen in Vorpommern liegt ihre Region am Herzen

Was denken die Menschen über die Region, in der sie leben? Was ist ihnen wichtig? Und was sollte ihrer Meinung nach verbessert werden? Diesen und anderen Fragen geht das praxisorientiere Forschungsprojekt Vorpommern Connect vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie in einer Bevölkerungsbefragung nach.
Eines der Ergebnisse: Den Teilnehmenden liegt ihre Region am Herzen. Rund zwei Drittel der Befragten sind täglich mehr als eine Stunde in der Natur unterwegs. Und etwa 80 Prozent stimmen mehr landwirtschaftlichen Produkten für den heimischen Markt zu. Für die Studie wurden Fragebögen per Post an 12 500 zufällig ausgewählten Personen in Vorpommern verschickt. Knapp 17 Prozent der Angeschriebenen haben die Fragebögen ausgefüllt und zurückgeschickt. „Das ist für diese Art von Befragungen ein hoher Rücklauf. Allein dies belegt das große Interesse der Bevölkerung an Informationen über die Region, in der sie leben. Die Antworten helfen uns, die Sichtweise der Bevölkerung auf die landwirtschaftlich geprägte Umwelt in Vorpommern zu beurteilen“, so Judith Maruschke vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie. Sie begleitet die Befragung als wissenschaftliche Mitarbeiterin. In den kommenden Monaten werden die Ergebnisse in einer „VoCo Road-Show“ in öffentlichen Veranstaltungen in Stralsund, Greifswald und Anklam vorgestellt und mit der Bevölkerung diskutiert.
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,5 Millionen Euro innerhalb der Maßnahme Stadt-Land-Plus gefördert. Praxispartner sind die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Michael-Succow-Stiftung.
Chronische Schmerzen verändern die Funktion und die Struktur des Gehirns
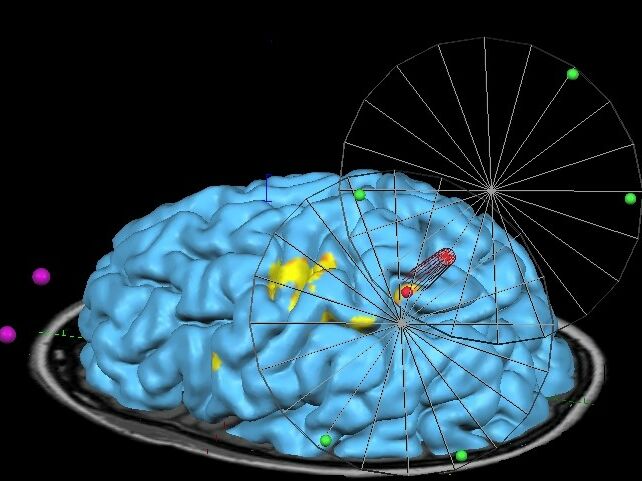
Wer hat sich nicht schon mal einen Finger in der Tür gequetscht oder den Kopf angeschlagen und dabei große Schmerzen empfunden. Doch was passiert, wenn der Schmerz nicht mehr weggeht, sondern über Monate intensiver wird oder sogar seine Qualitäten ändert, einen nachts weckt und Bewegung verhindert? Chronische Schmerzen, wie etwa Rückenschmerzen, treten sehr häufig auf. Medikamente helfen sehr oft nicht dauerhaft und es entsteht eine Spirale aus sozialem Rückzug, Bewegungsmangel und noch stärkerem Schmerz. Unter den vielen Arbeitsgruppen, die an der Universitätsmedizin Greifswald in diesem Bereich engagiert sind, forscht die Funktionelle Bildgebung am Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie vor allem daran, die Mechanismen neuronaler Veränderung bei der Ausbildung chronischer Schmerzen zu erkennen. Diese Biomarker sollen dann dabei helfen Interventionsprogramme zu optimieren (zum Beispiel mithilfe eines Trainings Schritt für Schritt wieder in die Bewegung hineinzukommen) oder besonders anfällige Personen frühzeitig für eine Schmerzchronifizierung zu erkennen.
Die Hiddenseer Dünenheide ist bedroht durch Nährstoffeintrag und Klimawandel

Heideflächen nahmen in Nordeuropa noch vor hundert Jahren großen Raum ein, wurden aber nach und nach aufgeforstet oder unter Einsatz von Kunstdünger in Ackerflächen umgewandelt. Heute sind nur noch fünf Prozent dieser Flächen erhalten. Dadurch sind nicht nur die Lebensräume, sondern auch die typischen Tiere und Pflanzen der Heide bedroht. Ebenso wie Moorflächen speichern Heideflächen erhebliche Mengen an Kohlenstoff in ihrer Rohhumusauflage.
Traditionell wurden Heideflächen beweidet, vor allem mit Schafen. Bei Aufgabe dieser Bewirtschaftung unterbleibt auch der kontinuierliche Nährstoffaustrag, was zusammen mit der gestiegenen atmosphärischen Stickstoffdeposition zu einer Nährstoffanreicherung führt. Die „typische“ Heidepflanze Besenheide (Calluna vulgaris) ist bei Nährstoffanreicherung nicht mehr konkurrenzkräftig. Die Heide vergrast, und die Rohhumusauflage wird mehr und mehr abgebaut. Eine weitere Bedrohung für die schon von Natur aus trockene Heide können trockene Sommer sein, vor allem, wenn diese bei fortschreitendem Klimawandel häufiger auftreten.
Die Arbeitsgruppe Experimentelle Pflanzenökologie der Universität Greifswald und die zu dieser Arbeitsgruppe gehörende Biologische Station Hiddensee untersucht den Einfluss von Nährstoffbelastung und Klimawandel auf die Heide. In Zusammenarbeit mit dem Hiddenseer Dünenheide e. V. werden Pflegemaßnahmen in der Heide durchgeführt, Öffentlichkeitsarbeit geleistet und Handlungsempfehlungen für den Naturschutz abgeleitet.
Sie wollen mehr dazu lesen? Hier geht's zur Studie „Management regimes in a coastal heathland – effects on vegetation, nutrient balance, biodiversity and gain of bioenergy“.
Weltweit gehen täglich mehr als 2000 Hektar Anbaufläche durch Bodenversalzung verloren
Bislang sind Bodenversalzungen vorrangig aus ariden Klimaregionen wie Australien bekannt. Dort müssen aufgrund der geringen Niederschläge und einer gleichzeitig hohen Verdunstungsrate landwirtschaftlich genutzte Flächen notwendig bewässert werden, um Erträge zu erzielen. Die Anreicherung von Salz im Boden wird durch salzhaltiges Wasser verursacht, das vom Grundwasser kapillar aufsteigt oder als Bewässerung infiltriert und nahe der Oberfläche verdunstet. Dabei fällt Salz aus. Weltweit gehen so täglich mehr als 2000 ha Anbaufläche verloren, das sind mehr als 2000 Fußballfelder.
Werfen wir einen Blick auf unsere Region. Zwei Jahre, in denen die Böden Nordostdeutschlands außergewöhnlicher Dürre ausgesetzt waren, führen zu der Sorge, ob Bodenversalzung auch bald ein Thema hierzulande sein könnte – vor allem auch vor dem Hintergrund sich verändernder Niederschlagsverteilungen und steigender Meerspiegel im Zuge des Klimawandels. In Deutschland werden durchschnittlich nur 1,5 Prozent (jährlich 0,3 Mrd m3) der Gesamtwasserentnahme zur Bewässerung genutzt – im europäischen Durchschnitt sind es 36 Prozent. Das oberflächennahe Grundwasser wie auch das zur Bewässerung verwendete Wasser ist in der Regel nicht salinar, d.h. der Salzgehalt ist kleiner als 1 g/L. An der Küste und auf Inseln lagert süßes Grundwasser linsenförmig auf tieferem salinaren Wasser. Studien in den Niederlanden haben untersucht, inwieweit ein ungünstiges Zusammenspiel von Meeresspiegelanstieg, Temperaturanstieg, salzhaltigem Grundwasser und eine Bewässerung mit ebenfalls salinarem Wasser eine Bodenversalzung langfristig begünstigen können. Danach ist nicht zu erwarten, dass die Versalzung die Salinität des Grundwassers übersteigt; wenn zudem das zur Bewässerung genutzte Wasser einen geringeren Salzgehalt hat, wird der Prozess abgemildert.
Diese Ergebnisse und Zahlen lassen eine akute Gefahr der Versalzung und damit Bodendegradierung in unserer Region nicht befürchten. Weitere Forschung zu diesem Thema wird aber ein sinnvolles Wassermanagement, vor allem auch in Küstenregionen, vorantreiben.
Mehr Infos: Prof. Maria-Theresia Schafmeister forscht am Lehrstuhl für Angewandte Geologie | Hydrogeologie und befasst sich mit Fragen der Grundwasservorräte und -qualität. Aktuell modelliert sie den Anstieg des Grubenwassers nach der endgültigen Schließung der Steinkohlezechen im Ruhrrevier.
Siehe auch: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung: UFZ Dürremonitor Deutschland, www.ufz.de
Elektrische Zahnbürsten beugen Zahnverlust vor

Diese Erkenntnis geht aus einer Studie Greifswalder Zahnmediziner hervor, die im vergangenen Sommer im Journal of Clinical Periodontology veröffentlicht worden ist. Der Zahnverlust bei Nutzer*innen elektrischer Zahnbürsten war im Schnitt ein Fünftel geringer als bei denjenigen, die konventionelle Bürsten verwenden.
Die elfjährige Beobachtungsstudie untersuchte den Zusammenhang zwischen der Benutzung einer elektrischen Zahnbürste und Parodontitis, Karies und Anzahl der vorhandenen Zähne. Die Studie umfasste 2.819 Erwachsene aus der Greifswalder Gesundheitsstudie Study of Health in Pomerania (SHIP), die von 2002 bis 2006 sowie nach sechs und elf Jahren erneut untersucht worden sind. Zu Studienbeginn verwendeten 18 Prozent der Studienteilnehmer und nach elf Jahren 37 Prozent eine elektrische Zahnbürste. „Elektrische Zahnbürsten sind in Deutschland in allen Altersgruppen beliebter geworden, aber nur wenige Studien haben ihre Langzeitwirksamkeit getestet“, sagt der Studienautor Dr. Vinay Pitchika von der Universitätsmedizin Greifswald. „Unsere Studie zeigt, dass elektrische Zahnbürsten für die Aufrechterhaltung einer guten Mundgesundheit am vorteilhaftesten sind und mit einem verminderten Fortschreiten von Parodontitis und mehr erhaltenen Zähnen einhergehen.“
Hier geht’s zur Medieninfo.
Lastenräder können zur Verkehrswende beitragen
Mit Lastenrädern lassen sich fünf Tonnen CO2 pro Jahr, im Vergleich zu einem herkömmlichen Pkw, einsparen und somit viele Dinge umweltgerecht transportieren. Mit dem zunehmenden Angebot an verschiedenen Modellen, steigt auch die Nutzung in der Bevölkerung. Mit einem Anteil von vier Prozent bei den E-Bike-Verkäufen in Deutschland 2019 wird eine Stückzahl von rund 54.400 erreicht. Hinzu kommen 21.550 verkaufte Lastenräder ohne Motor.
Lastenräder sind somit auch rollende Botschafter für eine menschengerechte Mobilität. Insbesondere in Kleinstädten mit vielen kurzen Wegen können sie zur Verkehrswende beitragen. Denn 80 Prozent aller Wege sind in Städten oftmals unter fünf Kilometern und Lastenräder könnten hier eine echte Alternative zum Auto darstellen.
Der Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie an der Universität Greifswald testet im EU-Interreg South Baltic Projekt „CoBiUM-Cargo Bikes in Urban Mobility“ Einsatzmöglichkeiten von Lastenrädern in verschiedenen städtischen Bereichen. Im Rahmen des Projektes sind außerdem für alle Greifswalder Lastenräder frei zugänglich.
Mehr über das Projekt: www.lara-greifswald.de
Trockene Moore sind Brandbeschleuniger in borealer Zone
Intakte Moore haben eine natürliche Schutzfunktion für das Ökosystem der borealen Zone und das globale Klima. Sie speichern große Mengen an Kohlenstoff und Wasser und dienen als natürliche Brandschneisen zwischen Waldgebieten. Durch die Erderwärmung ist diese Schutzfunktion jedoch gefährdet. Wenn die Temperaturen steigen, erwärmt sich auch die Luft und nimmt mehr Wasser auf. Im Gegensatz zu Nadelbäumen geben Moorpflanzen auch bei höheren Temperaturen weiterhin Wasser an die Luft ab und trocknen so das Moor langfristig aus. Trockene Moore geben in der Folge mehr Kohlenstoff an die Atmosphäre ab, was wieder die Erderwärmung beschleunigt. Damit wächst auch die Waldbrandgefahr, denn ausgetrocknete Moore bedeuten größere und intensivere Waldbrände.
Die Ergebnisse der Studie sind in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht. Diese hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der kanadischen McMaster Universität und Beteiligung der Arbeitsgruppe Landschaftsökologie und Naturschutz der Universität Greifswald zusammengetragen.
Hier geht's zur Medieninformation.
Kontakt an der Universität Greifswald
Hochschulkommunikation
Domstraße 11, Eingang 1, 17489 Greifswald
Telefon +49 3834 420 1150
hochschulkommunikationuni-greifswaldde