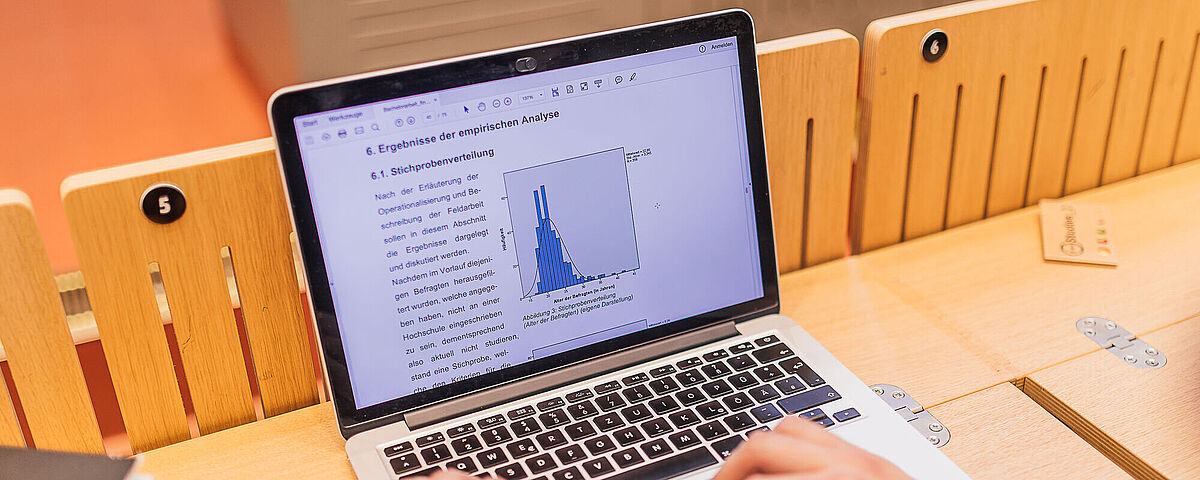Wissenschaft managen
Wie finanziere ich Forschungsprojekte nach Abschluss meiner Promotion? Wie kann ich als Postdoc internationale Kontakte knüpfen und vertiefen? Was muss ich bei der Antragstellung und Durchführung meines Forschungsprojekts beachten? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Unterstützung benötige?
WAS? Die Vortragsreihe "Wissenschaft managen" gibt einen umfassenden Überblick über die Anbahnung Ihres ersten Postdoc-Forschungsprojekts und die Bausteine für eine erfolgreiche Antragstellung und Durchführung. Die Vorträge werden von Expert*innen und relevanten Ansprechpartner*innen der Universität gehalten. In jeder Sitzung ist Zeit für die Beantwortung Ihrer Fragen vorgesehen.
Für WEN? "Wissenschaft managen" richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der späten Promotions- und frühen Postdoc-Phase an der Universität Greifswald und der Universitätsmedizin Greifswald. Forscherinnen und Forscher anderer Greifswalder Forschungseinrichtungen sind ebenfalls willkommen.
ZERTIFIKATE Es können Teilnahmezertifikate über die Graduiertenakademie ausgestellt werden.
Information für TN der strukturierten Programme der UMG: Sie müssen an mind. 8 Veranstaltungen teilnehmen, um 2 ECTS zu erhalten.
Vortragsthemen
Die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln wird immer wichtiger für den wissenschaftlichen Karriereverlauf nach der Promotion. In dieser Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten, finanzielle Förderung für eigene Forschungsvorhaben und eine eigene Stelle zu beantragen (Fokus auf Fördermöglichkeiten innerhalb Deutschlands), sowie über die Grundlagen der Antragstellung.
Von Early Career Researchern wird erwartet, dass sie während ihrer Karriere grenzüberschreitend mobil und vernetzt sind und sich in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft selbständig bewegen. Dafür steht eine Vielzahl an Förderinstitutionen und -programmen zur Verfügung.
In dieser Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Fördermöglichkeiten für kurz-, mittel- und langfristige Auslandsaufenthalte (Lehre und Forschung) und praktische Hinweise zur Antragstellung.
Es gibt keine Erfolgsgarantie, aber mit der richtigen Herangehensweise vermeiden Sie viele Stolperfallen bei der Vorbereitung eines Drittmittelantrages. In dieser Veranstaltung erhalten Sie praktische Hinweise darüber, wie Sie das richtige Förderformat finden, wie Sie Ihr Projektvorhaben richtig in Szene setzen, und nicht zuletzt was Sie bei der Ausgabenplanung beachten müssen.
"Wissenschaftliche Integrität bildet die Grundlage einer vertrauenswürdigen Wissenschaft", heißt es in der Präambel der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der DFG. In dem interaktiven Vortrag wird darauf eingegangen, was in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Integrität bzw. wissenschaftliches Fehlverhalten bedeutet und anhand der gängigsten Probleme in Fragen der Betreuung, des Publizierens und des Datenmanagements gezeigt, dass es zwischen beiden Extrema Grauzonen gibt. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wichtigsten nationalen und internationalen Regelwerke zur Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis und lernen die für die Universität Greifswald spezifische Satzung und das bestehende Ombudssystem kennen.
Wie kann Forschung über den akademischen Bereich hinaus sichtbar gemacht und die breite Öffentlichkeit sinnvoll einbezogen werden? Dies ist eine zentrale Frage, mit der sich viele Forscher heute konfrontiert sehen. Die Antwort liegt in der Wirksamkeit der Wissenschaftskommunikation, indem Sie Ihre Geschichte in einem für das jeweilige Publikum geeigneten Format erzählen, beispielsweise für die akademische Gemeinschaft, politische Entscheidungsträger, Förderinstitutionen und insbesondere die breite Öffentlichkeit.
Dieser Workshop bietet praktische Einblicke und konkrete Strategien, um Ihre Forschung klar, selbstbewusst und effektiv zu kommunizieren – sei es im Gespräch mit Journalisten, in sozialen Medien oder im direkten Dialog mit der Öffentlichkeit.
Die Abteilung für Hochschulkommunikation der Universität Greifswald und die Abteilung für Kommunikation und Marketing der Universitätsmedizin Greifswald stellen ihre Unterstützungsangebote vor und laden die Teilnehmer zum Gedankenaustausch ein. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen, sich mit Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen, oder bereits an konkreten Projekten arbeiten – bringen Sie Ihre Fragen mit und nutzen Sie diese Gelegenheit zum Austausch und Networking.
Gute wissenschaftliche Praxis bedeutet, sich nicht nur mit methodischen, sondern auch mit ethischen Fragen des Forschungsprozesses, auseinanderzusetzen. Bei den meisten Drittmittelgebern hat dieser Gedanke bereits Eingang in Leitfäden sowie Vorgaben für Antragsstellung und Projektgestaltung gefunden - und ist damit Standard. Bereits bei der Entwicklung einer Forschungsidee sowie der Antragstellung sollten wichtige ethische Grundsätze reflektiert und auch im Verlauf über das gesamte Forschungsprojekt hinweg berücksichtigt werden.
Wie nehme ich meine Verantwortung als Forschende*r war, welche Vorgaben muss ich bei der Entwicklung einer Forschungsidee und der darauffolgenden Antragstellung berücksichtigen?
Die digitale Datenverarbeitung hat neue Möglichkeiten für die Erfassung, Anzeige und Veröffentlichung von Forschungsdaten eröffnet. Die Möglichkeiten für den Austausch und die Wiederverwendung von Daten erfordern neue Kompetenzen im Bereich der Datenkompetenz. Ein guter Plan für die Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Forschungsressourcen ist für Datenveröffentlichungen unverzichtbar geworden. Die Anforderungen an das Datenmanagement werden immer vielfältiger – eine monolithische Lösung allein kann sie nicht mehr alle erfüllen. In diesem Vortrag werden wir die Schritte des Datenlebenszyklus diskutieren und die wichtigsten Konzepte für Forschungsdaten vorstellen. Wir werden auch auf Lösungen hinweisen, die Forschern durch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zur Verfügung stehen, und eine Einführung in Software-Tools und Beratungsdienste geben, die vom Rechenzentrum und der Universitätsbibliothek angeboten werden, um die oben genannten Herausforderungen zu bewältigen
Wissenschaftliches Publizieren ist eine der Kernaufgaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um die Ergebnisse der eigenen Forschung zu dokumentieren, zu präsentieren und letztlich einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. Zu einem adäquaten wissenschaftlichen Publizieren gehört heute nicht nur die Wahl der geeigneten Publikationsform und des Publikationsortes, sondern auch die Sicherung der Nutzungsrechte sowie der freie Zugang (Open Access) zu den veröffentlichten Forschungsergebnissen. Im Mittelpunkt des Vortrags steht daher die Frage, wie man ein geeignetes Publikationsmedium findet, was Open Access bedeutet, welche Wege zur Open-Access-Publikation führen und welche weiteren Aspekte beim wissenschaftlichen Publizieren zu beachten sind.
Forschungstransfer bedeutet nachhaltige Wissenschaft. Wissenschaftler haben die Verantwortung, die Ergebnisse ihrer Forschung für die Gesellschaft zugänglich und nutzbar zu machen. Oft bleibt ihr Potenzial jedoch ungenutzt, weil der nächste Schritt zur Anwendung nicht erfolgt. Anhand praktischer Methoden und inspirierender Beispiele zeigt Ihnen der Referent, wie wissenschaftliche Forschung über den akademischen Kontext hinaus gezielt in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wirken kann. Entdecken Sie das Anwendungspotenzial Ihres Forschungsthemas – egal, ob es sich um ein wissenschaftliches Experiment oder ein geisteswissenschaftliches Projekt handelt – und erfahren Sie mehr über Verwertungsmöglichkeiten und Anwendungspotenziale für Ihre Forschungsergebnisse!
Die Entwicklung KI-basierter Anwendungen eröffnet neue Möglichkeiten für Forschung und Lehre. Für die Literaturrecherche stehen mittlerweile eine Vielzahl von Tools zur Verfügung. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über KI-Anwendungen im akademischen Bereich, stellt Prompting-Strategien vor und erläutert, wie KI in der Literaturrecherche eingesetzt werden kann. Besonderes Augenmerk wird auf eine kritische Reflexion des Potenzials und auf die Herausforderungen von KI gelegt, während gleichzeitig ihre praktischen Anwendungsmöglichkeiten für die eigenen Forschungsaktivitäten der Teilnehmenden aufgezeigt werden.
Sex und Gender sind grundlegende Dimensionen der Vielfalt, die die meisten Aspekte des Lebens prägen oder beeinflussen – von den molekularen Grundlagen von Gesundheit und Krankheit bis hin zur asymmetrischen Verteilung von Macht und Ressourcen auf gesellschaftlicher Ebene. Die Bedeutung von Geschlechts- und Genderaspekten in der Forschung wird von wissenschaftlichen Einrichtungen (Deutscher Wissenschaftsrat) und Förderorganisationen (z. B. DFG, BMBF) zunehmend anerkannt. Infolgedessen ist die Berücksichtigung von Geschlecht und Gender (sowie anderer Dimensionen der Vielfalt) eine formale Anforderung in Förderanträgen.
ANMELDUNG "Wissenschaft managen" wird vom Zentrum für Forschungsförderung und Transfer (ZFF) und der Graduiertenakademie organisiert. Für die Teilnahme melden Sie sich bitte hier für die Veranstaltungsreihe an.
WANN und WO?
Die Workshop-Reihe findet wöchentlich dienstags, von 12.15-13.45 Uhr, online über Zoom statt. Nächster Start am 28. Oktober 2025.
Sara Hackert
Wollweberstraße 1
17489 Greifswald
Telefon +49 3834 420 1185
managingresearchuni-greifswaldde